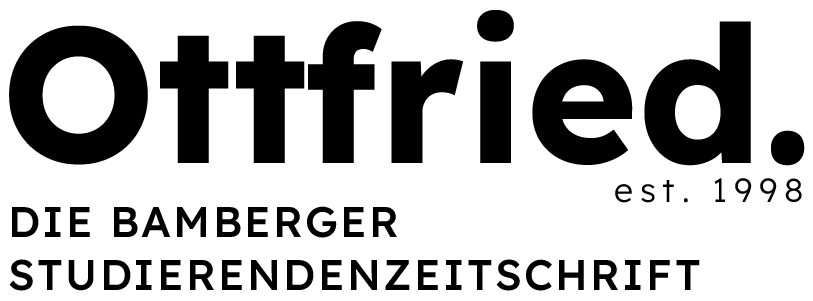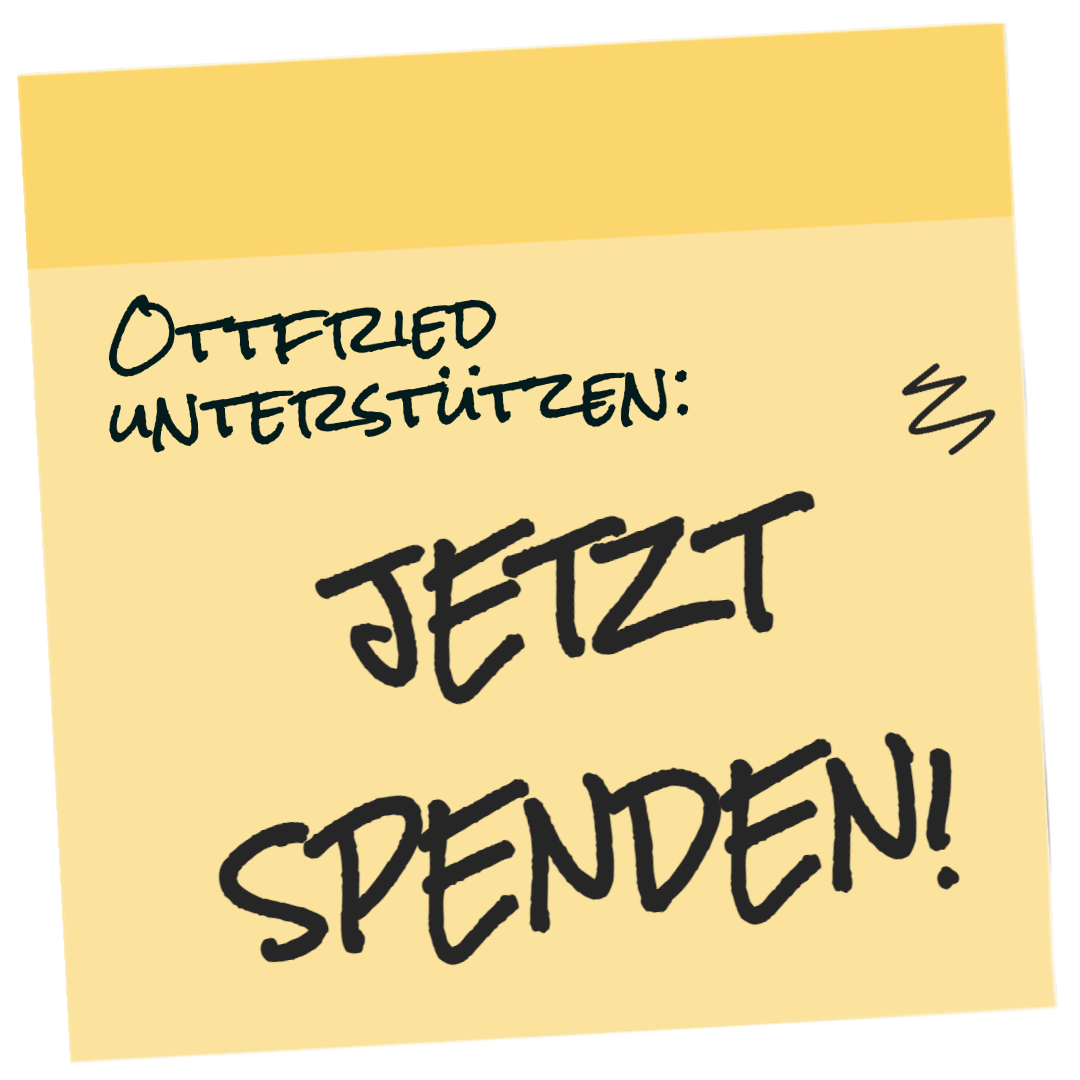Celina Ford, Jahrgang ´99, zog nach ihrem Bachelorstudium in der…
Mit dem Selbsttest „Welches Uni-Klo bist du?“ hatte Kim 2019…
Hilde ist Expertin in Sachen Fotolovestory, nur im eigenen Liebesleben…
Katharina Kitt, geboren '99 am Bodensee, steht auf Politik und…
Würde mich jemand fragen, was meine liebste Kunstform ist, wäre die Antwort sehr einfach: Musik. Ich liebe es, neue Künstler*innen zu entdecken und mich beim Hören regelrecht überwältigt zu fühlen. Weil das mit den Top 40-Hits ein relativ schwieriges Unterfangen ist, tendiere ich stark dazu, alles, was mit dem Label „experimental“ versehen ist, auszuprobieren. Und wenn dieses Label dann auch noch einem der unzähligen Metal-Subgenres voransteht, werde ich erst richtig euphorisch. Metal als Genre wird jedoch nicht nur durch seinen Sound konstituiert, sondern vor allem von einer Subkultur geprägt, die das Tragen von Merch und damit dem expliziten Supporten einer bestimmten Band als regelrechte moralische Pflicht empfindet. Fun Fact: Beim Schreiben dieses Texts habe ich gerade auch ein Band-Shirt an. Und obwohl das Tragen von Band-Merch natürlich die Künstler*innen vordergründig visuell und auch finanziell unterstützen soll, dienen diese Kleidungsstücke ganz klar dazu, die Persönlichkeit nach außen zu tragen und den eigenen ach-so-obskuren Geschmack in die Welt hinauszuposaunen.
Es wäre schlicht gelogen zu behaupten, dass es mich nicht freuen und kitzeln würde, wenn ich auf ein Band-Shirt angesprochen werde. Tatsächlich ist es so, als würden geheime „Schaut an wie anti-Mainstream ich bin“-Gebete erhört werden. Ein genauso dunkles Geheimnis ist meine Abneigung gegen das Tragen von Bands, die man nicht wirklich hört – quasi als modisches Shirt zur Lederjacke (I’m looking at you, KISS, AC/DC und Konsorten). Gleichzeitig weiß ich, dass dieses Denken lächerlich ist. Glaubt mir, wenn ich sage, dass mir beim Schreiben dieser Zeilen schlecht vor Cringe wird. Trotzdem ist es Fakt, dass ich mich sehr über das, was ich höre und im Umkehrschluss über das, was ich trage und supporte, definiere. Doch ist das wirklich so gut? Ich bin mir natürlich bewusst, dass ich weit mehr bin als das, was ich höre, lese, sehe, konsumiere. Dennoch ist es so viel einfacher, mich beispielsweise in ein Zeal & Ardor-Shirt zu kleiden und als Musikkennerin imaginär feiern zu lassen, anstatt auf den richtigen Zeitpunkt für deepe Gespräche zu warten. Weil das Cringe-Barometer aber beim Tippen wieder in die Höhe schnellt, merke ich für mich selbst: Vielleicht wäre ein neues Denken über das Tragen von Band-Merch ein guter, verspäteter Neujahrsvorsatz.
Von Celina Ford
Mein Kleiderschrank hat zwei Schiebetüren. Wenn ich sie morgens verschlafen aufschiebe, erblicke ich Oberteile, die farblich sortiert auf Kleiderbügeln hängen. Außerdem liegen dort vier Stapel mit Shirts, zwei davon sind weiß, einer grau-braun und einer schwarz. Farbenfreude? Fehlanzeige!
In der kalten Jahreszeit dominiert die Farbe schwarz: schwarze Doc Martens oder Vans, eine schwarze Stoffhose, schwarzer Wollpullover, so fühle ich mich wohl. Im Sommer, meiner Lieblingsjahreszeit, wendet sich das Blatt und für all meine hellen Kleidungsstücke beginnt ihre time to shine. Dann laufe ich liebend gerne weiß gekleidet durch die Gegend mit passender beiger Handtasche, hell-glitzernden Birkenstocks oder weißen Sneakers.
Die Gründe für meinen farblich reduzierten Kleidungsstil kann ich nur erahnen, denn er hat sich schleichend über die letzten Jahre entwickelt und tut das nach wie vor stetig weiter. Vielleicht schreibe ich ja in fünf Jahren einen Artikel, warum ich rote Kleidung liebe (side fact: rot und gelb sind tabu und in meinem Schrank nicht zu finden).
Grundsätzlich gefällt mir ein minimalistischer und ordentlicher Stil besser, auch bei meiner Einrichtung. Außerdem bringen die gedeckten Töne meiner Klamotten einige Vorteile mit sich. So bieten sich mir viele Kombinationsmöglichkeiten, denn farblich beißen tut sich in meinem Schrank wenig. Nur die Schnitte einzelner Kleidungsstücke können manchmal das KO-Kriterium für eine Kombi sein, die ich mir in meinem Kopf ausgemalt habe. Auch beim Kofferpacken kommt mir mein Stil zugute, denn grundsätzlich passen meine Kleidungsstücke zusammen.
Bestimmt gibt mir mein Modestil auch Sicherheit, vor allem an Tagen, an denen ich mich nicht wohl oder ängstlich fühle. Dann schlüpfe ich in ein dunkles oversized Outfit ,wissentlich, dass die Blicke anderer Menschen eher an mir vorbei schweifen, als auf mir haften zu bleiben. Die Blicke und von mir angenommenen Meinungen anderer Menschen zu meinem Aussehen, spielen für mich ebenfalls eine große Rolle. Mein Aussehen sollte im besten Fall positiv auffallen, im schlechtesten Fall in der Masse untergehen, so lautet die Devise. Dass mir egal ist, was andere über mein Erscheinungsbild denken: an diesem Punkt bin ich noch lange nicht. Nur an Tagen, an denen ich mich richtig wohl in meiner Haut fühle und das Gefühl habe, mein Look repräsentiert dieses Empfinden, wird der Gedanke an meine Wirkung auf andere unwichtig.
Von Paula Eiselen
Wenn ich mich morgens anziehe, wähle ich meistens das aus, worauf ich für den Tag Lust habe. Mal bin ich funny drauf und dann darf es gewagter sein und manchmal habe ich Lust auf einen minimalistischen Look. Dann stehe ich vor dem Spiegel und überlege, ob mir gefällt, wie ich aussehe. Ich habe dann oft keine komplett eindeutige Antwort, sondern schwanke zwischen einem guten Bauchgefühl und Zweifeln am Outfit. Warum bin ich so unsicher? Warum zweifle ich an dem, worauf ich eigentlich Lust hatte? Ich glaube dahinter steckt oft die Angst nicht feminin genug oder „unförmig“ auszusehen.
Wir haben Schönheitsideale verinnerlicht und dazu zählt oft, dass eine Frau schön gekleidet ist, wenn sie von Weitem als Frau eingeordnet werden kann und am besten noch, wenn man eine gute Figur unter der Kleidung erkennen kann. Dass das uncool ist, ist kein woker Gedanke mehr, sondern fast schon mainstream – aktuelle Trends richten sich oft gegen diese veralteten Ideale. En vogue sind beispielsweise schon lange weite Jeans für Mädels, Blusen für Jungs, Hosenanzüge für Frauen und auch Röcke für Männer werden populär. Aber mein Gefühl feminin aussehen zu müssen, löst sich auch trotz solcher Trends nur langsam.
Ich merke immer wieder, dass sich meine Zweifel auf mehr beziehen als Schönheitsideale. Ich glaube die Wurzel liegt im verinnerlichten Gedanken, dass man in jedem Outfit attraktiv aussehen sollte – und das erscheint mir wie eine Umschreibung für „begehrt“. Denn wir machen die Wertung über das eigene Auftreten meistens davon abhängig, welche Blicke wir bekommen und wie anziehend wir empfunden werden. Der Fokus liegt darauf, wie andere uns wahrnehmen und nicht darauf, wie wir uns selbst wahrnehmen. Wir versuchen andere zu beeindrucken und achten dabei selten darauf, was uns gefällt.
Ich nehme mir ab jetzt vor, mir eigene Ideale zu definieren und mich im besten Fall nur noch danach zu richten, was mir gefällt. Dass die Zweifel dabei nicht von heute auf morgen verschwinden ist klar, aber mit Geduld fühlt man sich nach ein paar Outfits vielleicht schon deutlich unabhängiger von den Blicken und Meinungen und freut sich mehr über die eigene Schönheit.
Von Kim Becker
Über die Jahre hinweg, hat sich mein Style stark verändert. Mit 15 Jahren habe ich nur schwarz getragen. Ich hatte nicht ein weißes Kleidungsstück in meinem Schrank. Wenn ich mit meiner Mutter einkaufen war, hat sie mich angebettelt mir farbige Sachen auszusuchen, doch ich ließ mich nicht überreden. Ich hatte mir klare Regeln ausgedacht, was mir steht und was nicht.
In den letzten Jahren kämpfe ich mit mir selbst, mich nicht mehr so sehr einzuschränken. Nur gegen Hotpants hege ich eine leidenschaftliche Abneigung. Im Sommer trage ich gerne Kleider oder Röcke, was früher unvorstellbar gewesen wäre. Die Beinfreiheit ist einfach einmalig. Auch die Schnitte meiner Hosen und Oberteile sind vielseitiger. Ob weit oder formpassend, ich bin viel offener. Hauptsache ich kann meine Oberteile in meine Hose stecken. Mein Style ist gerade sehr von den 20er bis in die 80er Jahre beeinflusst. Dabei möchte ich nicht den Style dieser Epochen nachbilden. Ich besitze beispielsweise einen Hut im Stil der 30er Jahre (ich kann Mützen nicht ausstehen), jedoch heißt das nicht, dass der Rest meines Outfits auch in diesem Stil gehalten sein muss. Mix and Match ist mein Motto. Gerade bei Jacken kann ich oft nicht widerstehen. Mein Lieblingsstück ist zurzeit eine braune Tweed-Jacke aus den 70er Jahren. Das spiegelt meine Farbvorliebe im letzten Jahr wieder. 50 shades of brown und mein geliebtes dunkelrot sind derzeit sehr dominant in meinem Kleiderschrank. Das gilt auch für meine Gürtel und Schuhe. Für mich ist braun das neue schwarz. Mein neuester Kampf ist gegen meine ausschließlich schwarze Sockensammlung. Deswegen trage ich im Moment gerne bunte Wollsocken über meine Socken.
Meine neue Regel ist: erst anziehen, dann entscheiden. Manchmal muss ich mich zwingen aus dem Haus zu gehen. Es ist nicht so, dass ich mich dafür schäme, was ich anhabe. Ich liebe meine Kleidung. Sie ist einzigartig. Aber ich habe Angst vor der Meinung anderer. Aus Erfahrung weiß ich, dass es so ziemlich niemanden interessiert, aber ich muss es mir trotzdem manchmal selbst sagen. Sobald ich an all meine Kleidung gewöhnt bin, suche ich nach einer neuen Herausforderung, was auch manchmal mit einer neuen Kombination erreicht wird. Am Ende ist mir nur wichtig, dass mein Silberschmuck dazu passt, den ich jeden Tag trage. Denn das Gewicht und die sentimentale Bedeutung von meinem Ring, meiner Uhr und meinen Ketten um den Hals erden mich. Das ist, was mir die Sicherheit gibt, die ich brauche.
Von Hilde Olschewski
Mein Verhältnis zu meinem Kleidungsstil? Ich würde sagen: zwiegespalten. Eigentlich fühle ich mich die meiste Zeit ziemlich wohl in meinen Klamotten. Zwar wird es mir, je älter ich werde, immer gleichgültiger, was andere vielleicht von meinen Outfits halten könnten. Aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, frei von Unsicherheiten zu sein. Als ich zwölf Jahre alt war, bereicherte mich eine Person mit dem komplett überflüssigen Kommentar: „Sag mal, schwimmst du viel? Du hast ganz schön breite Schultern für ein Mädchen“. Dieser Satz begleitet mich bis heute, danke nochmal dafür. Und das ärgert mich. Es ärgert mich, dass ich mich manchmal immer noch nicht traue, bestimmte Oberteile zu tragen, weil ich denke, dass ich das nicht dürfte. Oder dass ich in meiner Jugend im Sommer oft unnötigerweise unter langen Oberteilen geschwitzt habe, weil ich einfach nicht selbstbewusst in meinem Körper war. Gut, das wird immer seltener und den Großteil meiner Unsicherheiten konnte ich zum Glück mit der Zeit ablegen. Aber manchmal erwische ich mich trotzdem noch dabei, dass ich, kurz bevor ich meine Wohnung verlasse, doch noch schnell mein Outfit ändere und auf altbewährte Optionen zurückgreife, bei denen mir nicht die leisen, aber fiesen Stimmen des Selbstzweifels in den Kopf schießen.
Doch es gibt Hoffnung: Denn das coole an Klamotten ist ja eben, dass das auch in die andere Richtung funktioniert. Wenn mir ein Outfit richtig gut an mir gefällt, unabhängig davon, ob es eher schlicht ist oder für meine Verhältnisse eher mutig, verändert sich mein Auftreten: ich gehe aufrechter, ich fühle mich viel selbstsicherer und strahle das auch aus. Ich wünsche mir für mich, dass ich mich zukünftig in allen meinen Outfits so fühle. Denn Mode soll gefälligst Spaß machen und frei sein von Erwartungen, die andere Menschen womöglich an mich und meinen Körper haben. In diesem Sinne hat es für mich auch durchaus etwas feministisches, empowerndes. Doch der Zusammenhang zwischen Mode und Feminismus in all seinen Facetten, das steht nochmal auf einem anderen Blatt.
Was kann man jetzt aus dieser Erzählung mitnehmen? Vielleicht den Reminder, Körper von Menschen einfach mal nicht zu kommentieren oder sich außerdem klarzumachen, dass sich niemand ernsthaft daran erinnern wird, was man anhatte.
Von Katharina Kitt
Ich trage seit diesem Winter einen leuchtend roten Mantel. Schon seit langer Zeit habe ich damit geliebäugelt, doch ich habe befürchtet, dass ich damit zu sehr auffallen würde. Ich habe genau ein Jahr gebraucht, bis ich mich getraut habe, meine Zweifel fallen zu lassen. In dieser Zeit habe ich modisch viel experimentiert und mich auch von der Ansicht gelöst, dass meine Kleidung figurbetont sein sollte. Ich habe bewusst öfter zu einer größeren Kleidergrößen gegriffen und liebe meine Mom-Jeans. Ein bisschen Stolz habe ich auch empfunden, als ich meinen neuen roten Mantel am Ende des Tages an meine Garderobe gehängt habe. Fast schon wie ein Symbol dafür, dass mein Selbstbewusstsein mehr wiegt als der gesellschaftliche Anpassungsdruck. Zwar hat mich ein kleiner Anteil in mir vor prüfenden Blicken und negativen Meinungen der anderen Menschen gewarnt.
Doch als ich zum ersten Mal in meinem neuen Kleidungsstück die Straße betreten habe, ist keine meiner Befürchtungen eingetreten. Lustigerweise sind mir am Ende ziemlich viele Menschen begegnet, die selbst Jacken in einem genauso kräftigen Farbton getragen haben wie ich. Wenn ich ehrlich bin, wäre es mir an diesem Tag auch schlichtweg egal gewesen, ob eine andere Person einen unangenehmen Kommentar geäußert hätte. Ich habe mich wohl gefühlt, ab dem Moment, als ich mich nicht mehr durch einen unwahrscheinlich kritischen Blickwinkel betrachtet habe, den ich der Gesellschaft zugeordnet habe. Das hat mir zum wiederholten Male vor Augen geführt, dass der Mut zum Ausbrechen aus der Unauffälligkeit bewirkt, ein bisschen mehr man selbst sein zu können. Und eigentlich fallen wir weniger auf als wir denken und finden mehr Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen als vermutet. Das kann man, abgesehen vom Kleidungsstil, auch in anderen Bereichen anwenden, indem man in kontroversen Diskussionen seine Meinung vertritt oder an seine eigenen Ideen glaubt. Schließlich frage ich mich, warum wir generell so viel Zeit damit verbringen, über unsere Wirkung auf die Außenwelt nachzudenken. Manchmal kommt mir der Gedanke, wie es wäre, lieber zu sein als darüber nachzudenken, welchen Eindruck dieses Sein vermittelt. Deswegen versuche ich, stärker auf mein Gefühl und meine Intuition zu hören. Und in meinem roten Mantel fühle ich mich gut.
Von Elisa-Maria Kuhn
Celina Ford, Jahrgang ´99, zog nach ihrem Bachelorstudium in der nördlichsten Stadt Italiens aka Regensburg für ihren Master in Literatur und Medien nach Bamberg, ebenfalls eine Stadt mit Italien-Flair. Zufall? Beim Giornale Ottfried kann sie sich ihrer Leidenschaft, das Fachsimpeln über Kunst und Kultur abseits des Mainstreams, voll und ganz hingeben.
Mit dem Selbsttest „Welches Uni-Klo bist du?“ hatte Kim 2019 ihren journalistischen Durchbruch. Seitdem schreibt unsere Oma gegen Rechts über Themen aus Kultur, Lifestyle und Politik und hat aus ihrer Liebe zu Mutter Erde die Gewächshaus Bamberg Reihe ins Leben gerufen. Mittlerweile droppt sie außerdem regelmäßig Content auf Social Media.
Hilde ist Expertin in Sachen Fotolovestory, nur im eigenen Liebesleben hapert es ein bisschen, obwohl… Eigentlich ist der Ottfried ihre einzig wahre Liebe.
Katharina Kitt, geboren '99 am Bodensee, steht auf Politik und Popkultur. Sie verträgt keinen starken Kaffee, aber dafür starke Themen.