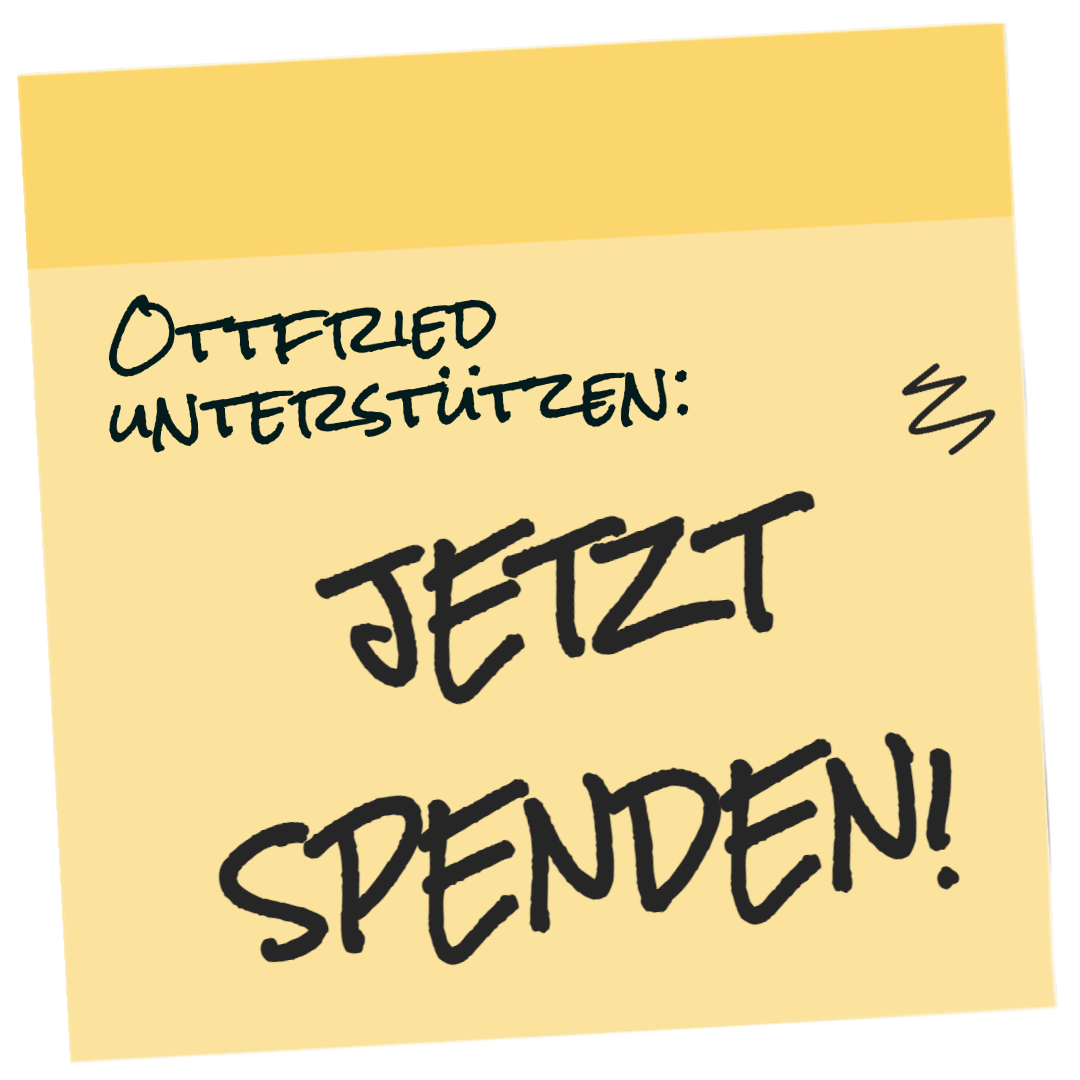Lea Fröhlich, Jahrgang 2000, wechselt eher selten das Programm von…

Mirjam Prell, Jahrgang 1999, hat sich über diverse journalistische Praktika…
Nicht erst mit Harry Styles‘ Vogue Auftritt beginnen Menschen mit schillernden Outfits regelmäßig die von der Gesellschaft gesetzten Grenzen der geschlechterspezifischen Klassifizierung von Klamotten zu überschreiten. Während es für Harry als weiße Person vermutlich leichter war, Aufmerksamkeit zu erlangen, hatten es sehr viele BIPOC, darunter Billy Porter, Prince, Alok Vaid-Menon oder Jaden Smith, da eher schwerer. Das ist höchstwahrscheinlich auf systemischen Rassismus zurückzuführen, würde daher mehr als einen eigenen Kommentar füllen können und daher hier den Rahmen sprengen. Einige weitere Namen sind Gwendolyn Christie oder Christine and the Queens, die für ihren Stil entgegen gesellschaftlicher Kleidungsnormen bekannt sind. Kleidung hat kein Geschlecht, im Gegenteil: ein „androgyner Stil“ war laut Harper’s Bazaar „2020 ein Trend“ und wird jetzt gefeiert. Wir hingegen waren mit unserem Aussehen in unserer Kindheit und Jugend aber alles andere als Trendsetterinnen.
Wir sind beide cis Frauen, uns wurde bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen und wir fühlen uns auch so. Im Kindergarten und in der Grundschule hatte ich, Lea, so wie alle anderen Mädchen, lange Haare. Meine waren lockig, es war eine Qual, sie zu kämmen. Als ich mich in meiner Familie umsah, stellte ich fest, dass sowohl meine Mutter als auch meine Großmütter und meine Tanten kurze Haare hatten. Allesamt starke Frauen, die ich mir als Vorbilder genommen habe. Nach der Logik meines neunjährigen Ichs blieb mir nur eins übrig: Haare ab. Raspelkurz. Ich verließ den Friseur mit einem Grinsen, denn ich fühlte mich endlich wie ich selbst. Als ich am nächsten Tag in die Schule kam, war die Reaktion meiner Klassenkamerad*innen wie ein Schlag ins Gesicht: „Du darfst nicht mit uns Prinzessin spielen, denn Prinzessinnen haben keine kurzen Haare.”
Als ich, Mirjam, mit acht vom Langhaar-Mädchen zum Bob wechselte, die Glitzershirts und Kleider langsam durch Jungsklamotten ersetzte und Reitstiefel gegen Fußballschuhe tauschte, spürte ich: Selbstbestimmung. Ich trug jahrelang glücklich die alten Sachen der Söhne befreundeter Mütter auf, verschwand in übergroßen Hoodies, Pullovern und Hemden und steuerte beim Neukauf zielsicher die Männerabteilung an. Dass ich nicht dasselbe wie die anderen Mädchen anhatte, machte mich stolz; wurde ich versehentlich für einen Jungen gehalten, konnte ich mein freudiges Grinsen kaum verbergen. Dann kam das Gymnasium. Und plötzlich waren da auch andere Gefühle.


Pubertät: Von Stolz zu Zweifeln
In der fünften Klasse hatte ich, Lea, zwei Pullis aus der Jungsabteilung. Einer war grau-schwarz, der andere gelb-schwarz gestreift. Rosa war nie meine Lieblingsfarbe. In meiner neuen Klasse angekommen, gab es erstmal Anwesenheitskontrolle. “Lea Fröhlich?” — “Ja.” — “Hm… Heißt es der oder die Lea?” Ein Loch im Erdboden hätte mir in diesem Moment geholfen. Wie mir meine Mitschüler*innen im Laufe der Zeit allerdings gebeichtet haben, haben sie sich die gleiche Frage wie meine Lehrerin damals gestellt.



Lea Fröhlich, Jahrgang 2000, wechselt eher selten das Programm von Lightroom oder Spark zu Word. Wenn sie dann doch mal zur Feder greift, geht es meist um Themen rund um die LGBTQIA+ Community. Ihr eigentlicher Platz ist und bleibt jedoch hinter der Kameralinse, was die anderen Otter*innen gerne ausnutzen.

Mirjam Prell, Jahrgang 1999, hat sich über diverse journalistische Praktika endlich zum Ottfried hochgearbeitet und verfolgt dort weiter ihren zukünftigen Berufswunsch. Ihre treuesten Begleiter sind Kaffee oder Mate. Wenn sie die Deadline nicht versehentlich vergisst, schreibt und produziert sie am liebsten rund um LGBTQIA+, "was mit Medien" oder Anderes aus dem (Studi-)Leben.