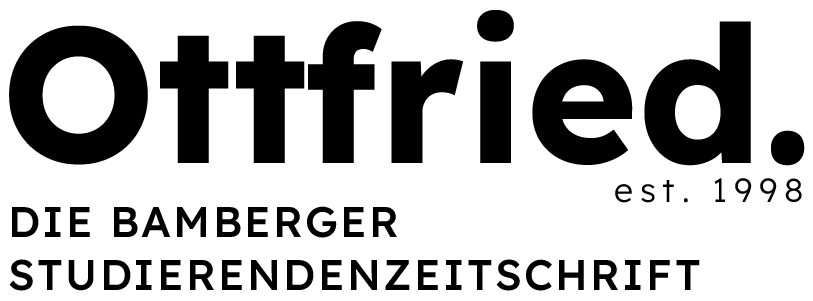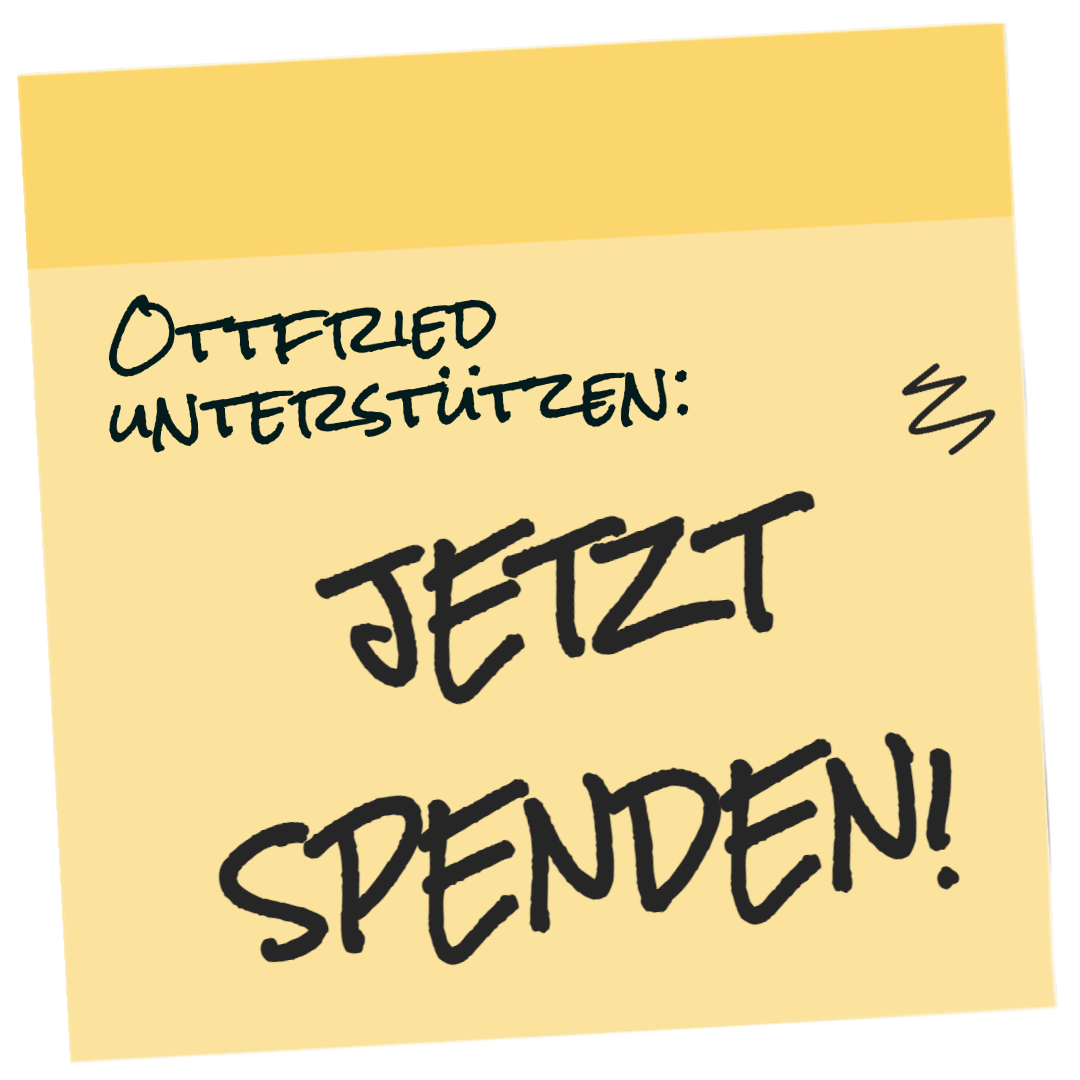Zärtlich fährt Daniel (Name geändert) jede Linie der Gravuren nach. Dem leeren Blick seiner hellbraunen Augen fehlt jede erkennbare Emotion. Wie in Trance steht er minutenlang da und streicht über das Holz. Dann hebt sich sein Brustkorb, er atmet rasselnd ein und wendet sich mit einem tiefen Seufzer ab. Daniel dringt weiter in sein altes Zimmer vor. Passiert die zwei hellbraunen Holzregale voller Fantasybücher und den Schreibtisch, auf dem sich rechts neben dem schwarzen Computerbildschirm die bunten Verpackungen unzähliger Online-Rollenspiele stapeln.
Als er das schlichte Bett mit der weißen Matratze erreicht, lässt er sich schwerfällig nieder. „So ganz werde ich mich davon wohl nie befreien können“, sagt Daniel leise. Die Kerben haben sich nicht nur in das Holz, sondern auch in seine Seele gegraben.
Verborgene Welten
Mehr als 400 Kindesmisshandlungen werden allein in Bayern Jahr für Jahr aufgedeckt. Die Dunkelziffer liegt laut Polizei und Opferhilfsorganisationen wie dem Weissen Ring weit höher. Daniel ist einer dieser unentdeckten Fälle. Etwa seit er zehn ist, wurde er von seinem Vater jahrelang misshandelt. Auf eine Entschuldigung wartet er bis heute vergeblich. Noch immer sprechen Vater und Sohn kaum miteinander, das letzte Mal umarmt haben sie sich vor drei Jahren, zum bestandenen Abitur des heute 23-Jährigen. Trotzdem kehrt Daniel regelmäßig in das Haus seiner Eltern im Landkreis Lichtenfels zurück. Zu den Büchern, in deren Welten er damals floh, und den Computerspielen, in denen er sich auch einmal als geliebter Held fühlte. Dort, wo er einmal nicht der verhasste Parasit war.
Masken
Mühsam unterdrückte Tränen glänzen feucht in Daniels Augen. „Dass ich heute hier sitzen kann, grenzt für mich an ein Wunder. Jahrelang habe ich mir sehnlichst den Tod gewünscht und heute genieße ich das Leben“, sagt er und wischt sich mit beiden Händen über das Gesicht. „Eigentlich müsste ich meinen Vater hassen, aber das kann ich nicht. Es fühlt sich krank an, das zu sagen, aber ich hab ihn trotzdem irgendwie lieb.“ Plötzlich fängt Daniel an zu lachen. Es hört sich eher an, wie ein bellendes Husten, während seine Gesichtsmuskeln eine Maske formen, die wohl ein Lächeln darstellen soll. „Es geht einfach nicht anders. Entweder du lachst darüber, oder es vernichtet dich“, sagt er, noch immer mit diesem verzerrten Lächeln auf den Lippen.
„Bitte nicht!”
Nach wie vor auf seinem Bett sitzend, sinkt Daniel schlaff in sich zusammen. Die Maske verschwindet. Sein Blick wird wieder starr und leer. Zögerlich fängt er an zu erzählen: von Schlägen, panischer Angst, Beschimpfungen und sinnloser Flucht. Für einen Moment ist er wieder das zwölfjährige Kind, das vor der in Wut verzerrten Fratze mit den heraustretenden Augen flieht. Kreischend und bettelnd um Tische und Stühle hetzt, in der Hoffnung zu entkommen. Vergeblich. „Er hat mich gejagt, bis er mich hatte. Es endete immer gleich“, sagt Daniel und erzählt davon, wie er sich zitternd und weinend in die hinterste Ecke seines Zimmers kauerte und gegen die Wand presste. Bettelnd „Bitte nicht, bitte nicht! Bitte!“ rief, während sein Vater die Hände nach ihm ausstreckte. Dann folgten die Schläge. „Blaue Flecken vergehen. Klar hat es wehgetan, und ich hatte damals unglaubliche Angst. Aber nicht die Schläge selbst haben mich kaputt gemacht“, sagt Daniel heute. Drecksack, Widerling, Arschloch, ekelhaftes Ding, Parasit. Diese Bezeichnungen gehen seinem Vater in den Jahren der Schläge nur allzu leicht über die Lippen. „Wenn ich hingefallen bin und Schmerzen hatte, hat er sich über mich gebeugt und mich ausgelacht. Es schien ihm richtig Freude zu bereiten.“
Gerechte Strafe
Langsam steht Daniel von seinem Bett auf. Seine Hände sind zu Fäusten geballt. „Wenn man Jahre lang zu hören bekommt, wie widerlich man ist, glaubt man es irgendwann selbst“, erklärt er. „Beim Gedanken an meinen eigenen Tod habe ich vor Freude geweint, aber so etwas Schönes hatte ein ekelhafter Parasit wie ich nicht verdient.“ Für einen Moment bricht Daniels Stimme, er schluckt. „Die einzig annähernd gerechte Strafe für so ein Ding wie mich ist es, weiterleben zu müssen. Davon war ich überzeugt“, presst er hervor und donnert seine rechte Faust gegen die Wandschräge über seinem Bett.
Allein?
Diese Einstellung bringt Daniel dazu, sich während seiner Schulzeit in Lichtenfels völlig zu isolieren. „Ich war ein Sonderling und gehörte nie dazu“, beschreibt er seine Situation. „Trotzdem war ich gerne dort, denn die Angst, nach Hause zu kommen, war größer.“ Daniels Mutter vermeidet es in diesen Jahren, das Verhalten ihres Mannes zu unterstützen. Sie setzt sich aber auch nicht offen für ihren Sohn ein. Noch immer leben beide Eltern zusammen. „Es war kurz nach meinem 14. Geburtstag, als sie mir das erste Mal gesagt hat, dass das, was mein Vater brüllt, nicht stimmt. Von da an hat sich alles geändert. Langsam, aber beständig.“
Es wird besser
Daniel sucht sich mit 17 Jahren selbstständig Hilfe und wendet sich an verschiedene Psychologen. Jeden Tag und jede Nacht kämpft er gegen den Selbsthass. Mit dem Übertritt in die elfte Klasse gelingt es ihm schließlich, sich mehr und mehr in der Schule zu integrieren, und auch zuhause bietet er seinem Vater immer häufiger die Stirn. 2012 beendet Daniel das Gymnasium erfolgreich mit dem Abitur und beginnt ein Studium an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
„Mittlerweile wohne ich seit über einem Jahr in einer WG. Es tut gut, Abstand zu haben”, sagt er. Als er diesmal lacht, leuchten seine tränennassen Augen. „Ich bin glücklich. Damals hätte ich es nicht für möglich gehalten, aber ich finde das Leben wirklich schön.” Für einen Moment steht er nur da und lächelt. Dann strafft er sich und geht auf den Schrank mit den eingeritzten Kerben zu. Wieder fängt er an, sacht über sie zu streichen. „Noch immer wache ich manchmal nachts inmitten einer Panikattacke auf oder schlafe tagelang kaum, weil ich Angst vor den Alpträumen habe. Aber es wird besser. Ich habe gelernt, an mich zu glauben, und angefangen, mich zu mögen. Es wird besser. Jeden Tag.”
Ein Blick zurück
Daniel sieht sich noch einmal in seinem alten Zimmer um. Lässt den Blick über das Bett, die Bücher und seinen Computer zurück zum Kleiderschrank schweifen. „Die Kerben zeugen von der dunkelsten Zeit meines Lebens und doch sind sie ein Teil von mir. Auch durch sie bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin. Ich hoffe, dass ich dadurch irgendwann ein liebevoller Vater sein kann.” Seine rechte Hand gleitet in die Hosentasche seiner Jeans und holt ein rotes Schweizer Taschenmesser hervor. Mit einem schabenden Geräusch gleitet die Klinge über das Holz. Eine neue Gravur ist entstanden: „Ich bin glücklich”.