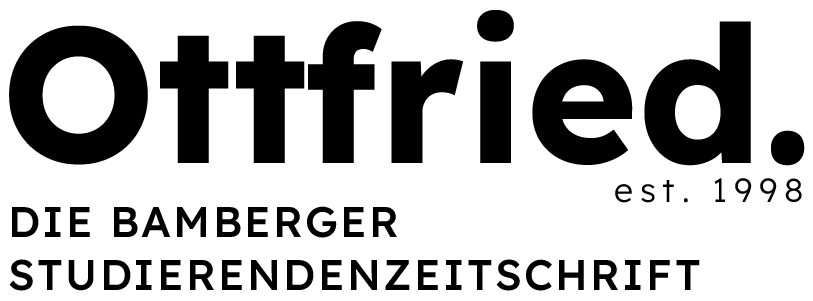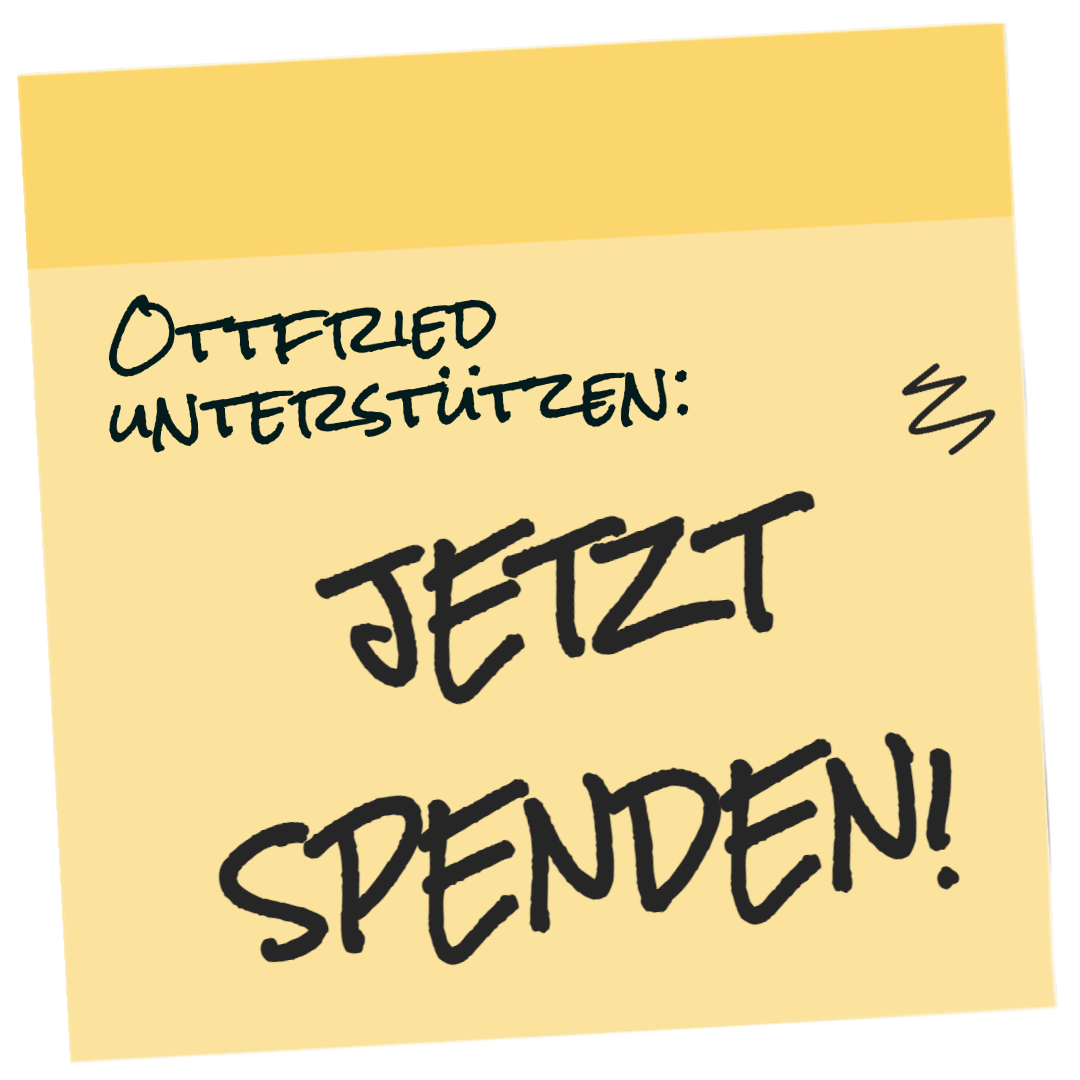Marie Rühle (Psychologie) isst zuviel Schokolade und lacht zu laut.…
Ich war am Boden. Ich konnte nicht mehr weinen, nicht mehr das Haus verlassen, gar nichts mehr. An Lernen war überhaupt nicht zu denken. Die Psychiatrie hat mich zwar nicht gerettet, aber sie hat mich vor Schlimmerem bewahrt.“ Cora*, 23, sitzt vor einem Café in der überfüllten Austraße, vor ihr ein Glas mit Eisschokolade. Es ist einer der ersten heißen Tage des Jahres; sie trägt ein schwarzes Sommerkleid und dunkelroten Lippenstift. Die Geschichtsstudentin ist klug, engagiert und hübsch – nicht der Typ von Person, bei dem man größere Probleme vermutet als Beziehungsstress oder eine schlechte Klausur. Die Narben an ihren Unterarmen fallen erst bei näherem Hinsehen auf.
Cora ist eine von 32.000 Studierenden in Deutschland, die sich 2016 an eine psychologische Beratungsstelle in ihrer Universität gewandt haben. Laut einer Studie des Deutschen Studentenwerks sind das 6.000 mehr als noch im Jahr 2011. Eine Entwicklung, die sich auch in Bamberg feststellen lässt: „In den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der hilfesuchenden Studierenden in der Beratungsstelle mehr als verdoppelt“, sagt Diplom-Psychologin Elisabeth Landgraf von der Psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studentenwerks Würzburg. Das bestätigt auch Mariella Büttner von der Sozialberatungsstelle: Im Jahr 2013 suchten sie 160 Studierende auf, 2016 waren es etwa 500. „Je bekannter das Angebot wurde, desto mehr wurde es genutzt.“
Auffällig ist, dass der Frauenanteil unter den Hilfesuchenden deutlich überwiegt. „Es kommen dreimal so viele Frauen wie Männer“, so Landgraf. „Die Gründe dafür sind sicher komplex. Ich meine, dass sich darin geschlechterspezifische Rollenanforderungen widerspiegeln, die auch heute noch vorherrschend sind. Männern werden in unserer Gesellschaft Probleme generell weniger zugestanden als Frauen oder es wird erwartet, dass sie Schwierigkeiten aus eigener Kraft lösen.“ Im Wintersemester 2016/17 hat sie Beratungsgespräche mit insgesamt 95 Bamberger Studierenden geführt.
Mit fünfzehn Jahren wurde bei Cora eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Zweimal war sie deswegen in stationärer Behandlung. Auf einen Therapieplatz warten Betroffene in Bamberg, wie an den meisten Orten, in der Regel mindestens ein halbes Jahr lang. Auch Cora war nach ihrem studiumsbedingten Umzug zunächst auf sich gestellt. „Meine Therapeutin, meine Familie und Freunde – alles, was mir vorher Kraft gegeben hatte, war von einem auf den anderen Tag weit weg“, erzählt sie. „Und dann die Umstellung von Schule auf Uni: das selbstständige Vor- und Nachbereiten der Vorlesungen, Frontalunterricht ohne Selbstbeteiligung, das stumpfe Auswendiglernen und Reproduzieren für gute Noten. In den großen Vorlesungssälen war man so anonym, niemand interessierte sich für einen, am allerwenigsten die Dozenten. Ich habe mich irgendwann einfach nur noch alleine und überfordert gefühlt.“
Deshalb wandte sie sich an die Psychotherapeutische Beratungsstelle. „Ich war mir zunächst unsicher, ob ich da überhaupt hingehöre. Fünfmal war ich da, im Abstand von etwa drei Wochen.“ Was aber jedem Betroffenen klar sein sollte: Die Beratung kann eine eventuell notwendige Therapie nicht ersetzen; sie ist eher als erste Anlaufstelle gedacht. Cora sieht sie als Überbrückungsmöglichkeit: „Natürlich hat es meine Probleme nicht gelöst, aber es hat gut getan, mit jemand unvoreingenommenen zu reden. Als ich mich einmal länger nicht gemeldet habe, kam eine Mail mit der Frage, wie es mir gehe. Das ist mir besonders in Erinnerung geblieben.“ Landgraf nahm ihre Probleme sehr ernst, machte ihr Mut und gab ihr Tipps, wie sie schneller an einen Therapieplatz gelangen könnte.
„Die meisten Studierenden kommen wegen studiumsbezogener Probleme“, sagt Landgraf. „Wenn die momentane Leistungsfähigkeit im Studium beeinträchtigt ist oder sogar das Risiko besteht, das Studium nicht zu schaffen, kann ein großer Leidensdruck entstehen. Oft liegen gleichzeitig private Probleme vor, die sich auf die Studierfähigkeit auswirken.“ Als Beispiele nennt sie unter anderem Trauerbewältigung oder Trennungen. „Insgesamt gesehen ist die Bandbreite der Anliegen in der Beratungsstelle sehr groß und reicht von zeitlich überschaubaren, gut zu bewältigenden Studiumsschwierigkeiten bis hin zu ausgeprägten psychischen Erkrankungen, die teilweise schon seit Jahren bestehen.“
Ein anderes großes Thema seien finanzielle Engpässe sowie die emotionale Unterstützung bei der Pflege von kranken Angehörigen. Bei diesen Problemen kann auch Mariella Büttner von der Sozialberatungsstelle weiterhelfen. Sie berät unter anderem bei Fragen zur Studienorganisation und ‑finanzierung, zum Anspruch auf Sozialleistungen und zu Nachteilsausgleichen bei BAföG und Prüfungen. An sie wenden sich auch internationale Studierende, Menschen mit Behinderung und studierende Eltern. Die Diplom-Pädagogin steht in Kontakt mit den anderen Beratungsstellen des Studentenwerks Würzburg und der Universität und kooperiert in vielen Fällen mit der Kontaktstelle für Studium und Behinderung, dem BAföG-Amt und weiteren Stellen.
„Einmal ging es mir gegen Ende des Semesters so schlecht, dass ich mich in psychiatrische Behandlung begab. Ich brach einfach alles ab“, schildert Cora. Zu diesem Zeitpunkt standen noch vier Hausarbeiten aus; Coras Freund setzte sich mit der Uni in Kontakt und bat um Verständnis für die Situation. „Alle Dozenten haben freundlich reagiert und mir einen Aufschub gewährt.“
Landgraf kann diese Grundhaltung unter den Dozenten bestätigen: „Studierende, die durch psychische Probleme vorübergehend weniger leistungsfähig sind und sich trauen, dies gegenüber Mitarbeitern der Universität offenzulegen, können meiner Erfahrung nach mit großem Verständnis rechnen. Auf der anderen Seite klagen Studierende häufig über enormen Leistungsdruck, bedingt vor allem durch die Menge an Leistungserhebungen.“
Auf die steigende Zahl der Betroffenen sind Uni und Studentenwerk wenig vorbereitet: „Es gibt eine einzige psychologische Beratungsstelle für dreizehntausend Studierende. Das ist einfach zu wenig“, so Cora. Sie erzählt: „Ich hatte 2015 Hoffnung, in die universitäre Selbsthilfegruppe aufgenommen zu werden, weil ich in der Uni überall deren Plakate gesehen habe. Aber als ich angefragt habe, hieß es, dass die schon voll sind.“ Mittlerweile wurde eine zweite Selbsthilfegruppe gegründet.
Heute sieht Cora das Studium positiver. Ihr persönlich habe es geholfen, ihren Tagesablauf und ihr Leben selbst planen und bestimmen zu können. „Und an sehr schlechten Tagen, wenn es gar nicht geht, kann ich auch einfach daheim bleiben“, sagt die 23-Jährige. Sie hat das Gefühl, dass psychische Krankheiten unter Studierenden eher toleriert werden: „Wenn in der Schule jemand meine Narben gesehen hat, wurde ich sofort dumm angemacht: Bist du ein Emo, oder was? Deswegen habe ich versucht, das möglichst zu verheimlichen. Heute ist das anders: Ich habe das Gefühl, dass ich diese Fassade nicht mehr aufrechterhalten muss. Natürlich erwähne ich es nicht ständig. Aber wenn ich darüber rede, stellt sich oft heraus, dass unglaublich viele Leute selber schon einmal betroffen waren oder immer noch sind. Meistens geht es da um Essstörungen oder Depressionen.“

Aus einem 2015 vorgestellten Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse geht hervor, dass jeder fünfte Studierende unter psychischen Problemen leidet – und das sind nur diejenigen, die eine ärztliche Diagnose erhalten haben. Die Dunkelziffer der Betroffenen, die sich noch keine Hilfe gesucht haben, kann nur erahnt werden.
Cora hat inzwischen, auch dank der Tipps von Frau Landgraf, einen Psychotherapeuten gefunden, mit dem sie sich einmal in der Woche zusammensetzt. Die Beziehungen zu ihrer Familie und ihrem Freund, die zeitweise unter ihrer Krankheit enorm litten, haben sich normalisiert. „Heute geht es mir viel besser als früher“, sagt sie, „aber ganz weggehen wird es natürlich nie. Borderline ist etwas, womit man einfach leben muss.“
*Name geändert

Marie Rühle (Psychologie) isst zuviel Schokolade und lacht zu laut. In der Redaktion verbessert sie gerne Zeichenfehler. Wäre ihr Leben ein Film, wäre es eine schwarze Action-Indie-Tragikomödie voller Sexwitze und ohne pädagogischen Wert. Marie würde sich definitiv beschweren, dass das Buch besser war - wie immer.