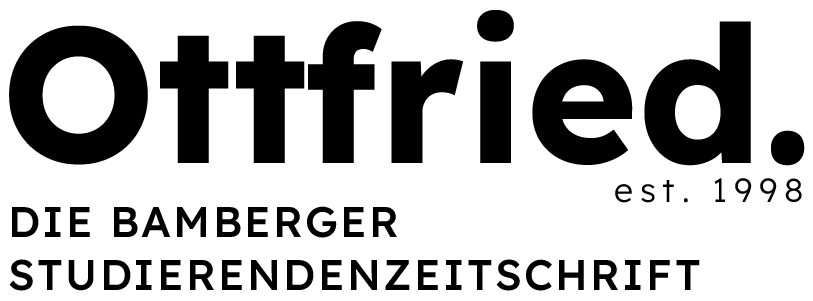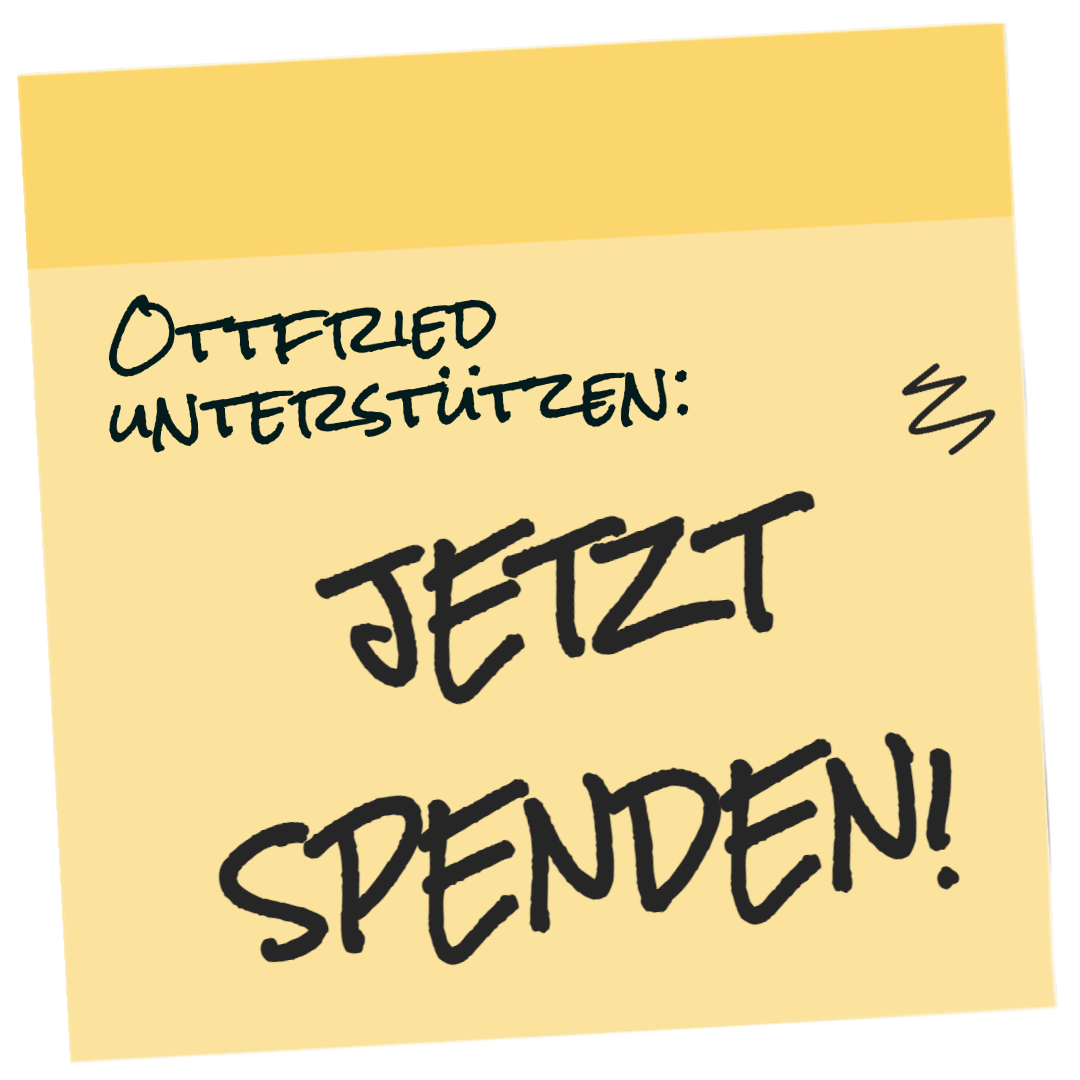Lena Mitterndorfer, Jahrgang 93. Fällt vor allem durch ihre roten,…
Markus*, 24, BWL-Student. Kurze Haare, braune Augen, sportlich, ein offener Gesprächspartner. Er wirkt wie ein ganz normaler Typ. Naja, seine Interessen sind vielleicht etwas speziell. Er schwärmt für Börsenthemen. „Option heißt, dass man entweder mit einem long/call auf einen steigenden Kurs setzt, oder mit short/put auf einen fallenden Kurs – nehmen wir beispielsweise die Siemens-Aktie, so wäre long eben das Setzen von 10 €…” Er könnte stundenlang darüber erzählen. Sein anderes Hobby ist das Angeln. Dabei ist er gerne alleine. „Da kann man schlecht Leute mitnehmen und reden. Das vertreibt mir ja die Fische“, sagt er lachend. Doch im Studium will er nicht allein sein. Echte Freunde hat Markus aber nur in seiner Heimat.Hier in Bamberg bezeichnet Markus seine Bekanntschaften als Kontakte. „Wie auf einer Elektronikplatine, auf der Lötkontakte drauf sind. Man ist irgendwie verbunden, aber auch nicht wirklich“, sagt Markus. Vor allem zu Beginn des Studiums lernte er noch viele Leute kennen. Dabei kamen rund 400 WhatsApp-Kontakte zusammen. Doch im Laufe des Semesters hätten sich Grüppchen entwickelt, erzählt Markus. „Innerhalb weniger Tage verabredeten die Leute sich zum Kochen, Weggehen und Trinken. Man wurde etwas ausgegrenzt von den Gruppen.” Die anderen Studierenden fragten selten, „ob ich mal mitwolle”, so Markus.
Auch Lea* tut sich schwer damit, neue Leute kennenzulernen. Sie ist 22 und studiert Politikwissenschaft. Ein freundliches, zierliches Mädchen mit langen braunen Haaren. Niemand würde auf den Gedanken kommen, dass es einer Person wie ihr schwerfallen könnte, neue Freundschaften zu knüpfen. Anfangs ist sie noch nach Bamberg gependelt. Ihre Gespräche mit Leuten aus der Uni beschränkten sich auf kurz vor und nach dem Seminar. „Ich bin nach der Uni immer heimgefahren, war abends nie mit den Anderen weg. Dadurch habe ich mich auch selbst etwas isoliert“, gesteht Lea. Als sie im zweiten Semester in eine WG gezogen ist, dachte sie, dass sie dadurch besser Anschluss finden würde. Doch vergebens.
Schnell merkte sie, dass es so nicht weitergehen konnte. Um etwas an ihrer Situation zu ändern, beschloss Lea, sich einer Hochschulgruppe anzuschließen. „Aber da hat sich dann auch erstmal nichts getan. Weil die schon so eine geschlossene Gruppe waren. Und ich bei vielen nicht wusste, worüber ich mich mit ihnen unterhalten soll. Da hat es irgendwie nicht gefunkt.“
Gefunkt hat es auch bei Markus nicht. Er wundert sich darüber, wieso es trotz eines deutlichen Überschusses an weiblichen Studierenden so schwer ist, nicht nur Freunde, sondern auch eine Partnerin zu finden.
Wie Lea hat auch er es mit Hochschulgruppen probiert. „Ich war schon aktiv, nur bekommt man oftmals mehr Kontakte als Freunde — so zumindest mein Eindruck. Man kommt in neue WhatsApp-Gruppen, bekommt viele Infos. Das war’s.“
Auf die Frage, wieso er nicht selbst die Initiative ergriffen hat und sich seinen Studienkollegen auf ein Feierabendbier anschloss, antwortet er: „Vielleicht lag es an mir, weil ich nicht fragte. Ich hatte ja schließlich ihre Nummern.“ Am Anfang seines Studiums ist er ab und zu noch mit ein paar Kommilitonen feiern gegangen. „Jetzt fehlen einfach die Leute. Alleine ausgehen macht ja selten Spaß. Mir fehlt dann hier der Kontakt, dass man sich beispielsweise in der Stadt verabredet.“ Aber man könne sich ja auch nicht einfach an einen Tisch mit fremden Studierenden setzen und mittrinken. Wie würde das denn auf die anderen wirken?
Lea sieht das etwas anders: „Ich denke, wichtig ist, dass man von sich aus versucht, auf die Leute zuzugehen und bei allen Sachen mitmacht. Dann läuft das schon.“ Lea empfindet die Hochschulgruppen trotzdem als hilfreich, da es eine einfache Möglichkeit bietet, mit anderen Studierenden ins Gespräch zu kommen.
Eigentlich versteht Markus gar nicht, dass er keinen Anschluss findet. Er sieht sich selbst als lebensfrohen und offenen Menschen, die Bamberger empfinde er dagegen oft als sehr verschlossen. Vielleicht müssten die Leute einfach nur ein bisschen mehr auf ihn zugehen.
*Namen geändert
Interview mit Prof. Dr. Jörg Wolstein, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie und seit 2007 an der Professur für Pathopsychologie an der Uni Bamberg
Wie stark hängt solch ein Verhalten von der Persönlichkeit des Einzelnen ab?
Es gibt Menschen, die eher introvertiert sind und denen es schwer fällt, soziale Kontakte zu knüpfen. Sie sind unsicher, gebunden oder misstrauisch allen Menschen gegenüber, die ihnen zu nahe kommen. Da gibt es eine Gruppe, denen macht das nichts aus. Sie sind zufrieden mit ihrem Leben. Und dann gibt es eine Gruppe, die darunter leidet, weil sie eigentlich doch gerne Kontakte hätten.
Und dann gibt es noch eine Gruppe von Menschen, die tatsächlich psychisch krank ist. Sprich sie sind depressiv, ziehen sich sozial zurück. Kontakte, die man bereits hatte, werden abgebrochen.
Beeinträchtigt solch eine Persönlichkeit auch andere Lebensbereiche?
Schwierigkeiten gibt es immer dann, wenn die, die sich nach mehr sozialer Unterstützung sehnen, darunter leiden. Aus dem Fehlen sozialer Kontakte kann zum Beispiel Suchtmittelkonsum resultieren, um die Situation zu kompensieren oder zu bewältigen. Der stille Trinker, der zuhause alleine für sich trinkt. Es können auch affektive Störungen entstehen. Menschen, die durch ihre Umweltsituation depressiv werden oder deren bestehende Depressivität dadurch verstärkt wird, dass sie keine sozialen Kontakte mehr haben.
Man darf das nicht unterschätzen. Soziale Unterstützung ist ein wesentlicher Aspekt für Gesundheit. Je mehr soziale Unterstützung ein Mensch hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gesund bleibt. Sowohl psychisch als auch physisch.
Wenn ich an die Uni komme und keine neuen Kontakte knüpfen kann, denken sich viele „mit mir stimmt was nicht“. Schrumpft durch so etwas das Selbstwertgefühl?
Manche Leute, die darunter leiden, denken sich das vielleicht. Andere denken sich dann stattdessen: „Die anderen Studenten sind komisch, nicht ich.” Das ist ein Selbstwertschutz. Man versucht, die Gründe in der Umgebung zu finden und wird dann oft abwertend, um seinen eigenen Selbstwert aufrecht erhalten zu können.
Inwiefern kann man sich Hilfe holen?
Man kann zur Psychosozialen Beratungsstelle gehen und sich überlegen, therapeutische Hilfe zu holen. Es gibt außerdem gut erprobte Trainings, die Betroffene besuchen können. Zum Beispiel Trainings zur sozialen Kompetenz, in denen man lernt, wie man Kontakte knüpfen und seine eigenen Interessen durchsetzen kann. Das können viele dieser Menschen nicht.
Was ist, wenn ich mich nicht sofort „outen“ möchte und zur Beratung gehen will?
Es gibt Ratgeber und eine Menge Laienliteratur. Ein Vorteil von solchen Ratgebern ist, dass man das erstmal machen kann, ohne sich outen zu müssen. Manchmal hilft es auch, wenn man in Selbsthilfegruppen andere Menschen trifft, die das selbe Problem haben. Das finde ich am sinnvollsten. Man kann aber auch Schauspielkurse besuchen, damit man lernt, über sich hinauszuwachsen.
Manchmal hilft es, sich einfach mal hinzusetzen und zu überlegen: „Ist es das Einsamsein wert? Oder sind die Kosten des Einsamseins einfach zu hoch?“