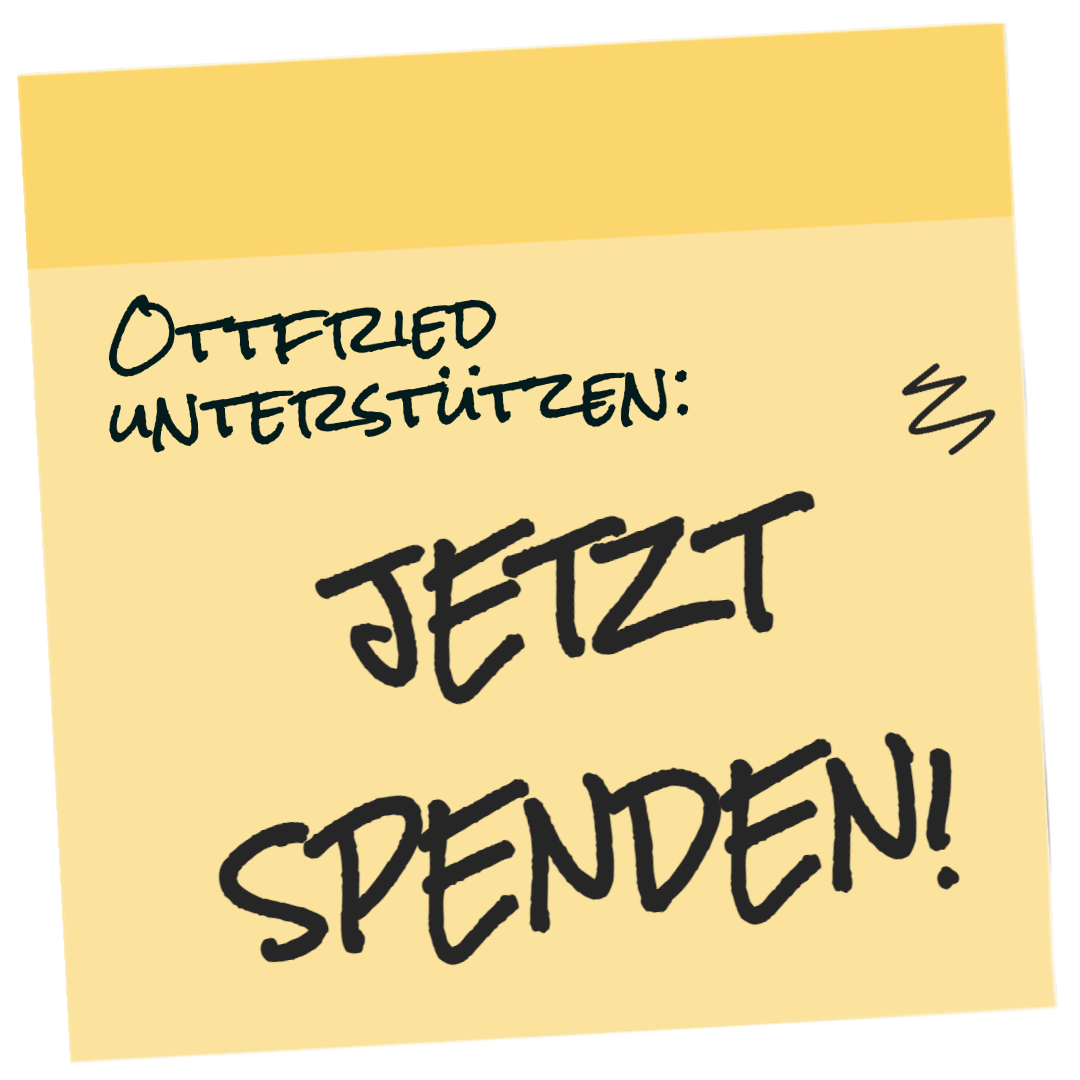Tim Förster, Unterfranke, Herkunft beim Sprechakt zum Glück unkenntlich. Seit…
Herr Nott, probt es sich mit den Symphonikern jetzt anders als früher?
Höchstwahrscheinlich schon. Ich habe lange gekämpft: Musik soll ständig in Bewegung sein. Deshalb muss von der ersten bis zur letzten Note ein Erzählungsbogen gebaut werden. Dazwischen darf kein einziger entspannter oder aussageloser Takt sein. Diese feine Flexibilität, die ich möchte, ist jetzt im Blut der Musiker. Nach einer gewissen Zeit hat man einfach eine vielfältigere Maschine und fährt schneller um die ganzen Racetracks. Einiges muss man jetzt nicht mehr ansprechen und das spart doch viel Zeit. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass es leichter wird.
Schleicht sich da Routine ein?
Dagegen habe ich immer total gekämpft. Sich nur auf einem Niveau zu halten, ist für mich gleichbedeutend mit einem Abgang, ich glaube auch in anderen Bereichen. Man muss besser sein. Musik ist ja nicht schwarz-weiß gemalt. Wenn ich ein Stück in 16 Jahren zehnmal gemacht habe, werde ich immer wieder eine neue Perspektive haben, neue Sachen entwickeln und aussagen wollen. Man darf sich nicht zurücklehnen, das ist ein Kampf gegen den Alltag und die Zufriedenheit. Wahrscheinlich ist das der Schlüssel, warum wir immer noch so gut miteinander musizieren können.

Ist es in Bamberg nicht schwer, sich nicht zurückzulehnen? Hier lässt es sich doch gut leben.
Am Anfang war mir diese Stadt etwas fremd. Ich war jung als ich herkam und hatte in große Fußstapfen zu treten und fragte mich, wie ich diesen Job würdig ausfüllen könnte. Und dann war da diese etwas langsamere Art der Stadt. Wir sind one-horse-town, das heißt es gibt keine Konkurrenz, die sonst den Musikern einen Schub gibt. Am Anfang war das ganze Ding ein bisschen träge und ich war im Kampf mit dieser Stadt. Aber die Möglichkeit, nicht gehetzt zu sein und sich selbst zuhören zu können, ist hier ein Vorteil. Und dann ist es doch, wie ich finde, eine lebendige Stadt mit Kunst in jeder Ecke. Jetzt finde ich sie nicht mehr bedrohlich. Das ganze Umfeld kommt an den Wochenenden zusammen und es gibt sehr viele Studenten hier, das finde ich sehr positiv. Hier passiert Kunst, das ist inspirierend. Jetzt bin ich eins zu eins mit dieser Stadt.
Und jetzt gehen Sie.
Die Entscheidung, wegzugehen, fiel bei mir vor ungefähr drei, vier Jahren. Ich hatte immer genossen, dass meine Laufbahn aus Verträgen von maximal vier Jahren bestand. Das hat natürlich eine Unsicherheit im Vergleich zu den Orchestermusikern, aber man weiß auch, dass man das Leben innerhalb von kürzester Zeit völlig ändern kann. Ich habe es sehr genossen, sozusagen auf der Kante des Lebens zu sein. Und jetzt dachte ich, wir streiten hier nicht so oft, man könnte eigentlich weiter machen. Aber ich dachte mir auch, dass es für das Orchester nach 16 Jahren mit einem Chef gut wäre, sich selbst neu definieren zu müssen.
Wenn ich mein eigenes Ego hervorhole, stehe ich im Weg.
Wie ist die Abschiedsstimmung bei den Symphonikern?
Diese letzten Phasen sind sehr rührend. Gerade in den letzten sechs Monaten kommen viele Leute zu mir und suchen den Kontakt, im Lift oder wo auch immer. Ich weiß, dass es für die ja auch ein Abschied ist. Man kann die musikalischen Erlebnisse nicht einfach von den menschlichen trennen, weil man durch die Musik gemeinsam geprägt wird. Es gab manchmal Streit und dann riesige Liebe, also ganz normal. 16 Jahre sind sehr lange in einem menschlichen Leben, und ich sehe die Gesichter der Musiker, wenn ich diese Musik mache. Man muss eine gewisse persönliche Nähe finden, sonst macht man keine gute Musik.
Gibt es manchmal das Problem, gegen Unstimmigkeiten innerhalb des Orchesters ankämpfen zu müssen?
Chefdirigent zu sein ist gekoppelt mit einer Verantwortung, sogar für das private Leben der Musiker. Wenn irgendjemand in der Probe schlecht gelaunt ist, will ich wissen wieso und was man dagegen tun kann. Ich nehme das sehr ernst. Die Musik soll diese Menschen zusammenführen und Dinge drum herum erst mal ausradieren. Das Bamberger Orchester ist sehr gesund. Die reden viel miteinander, wir gehen ja auch oft auf Tournee.
Wie wird im Orchester interpretatorisch mit der Musik umgegangen?
Ich recherchiere ständig, was wie interpretiert werden kann. Meine Partituren sind voller Notizen, 2001 das, 2003 das komplette Gegenteil, wie Tagebücher. Und natürlich hat auch jeder Musiker eine eigene Meinung, gerade wenn die Stücke sehr bekannt sind, und das ist ein gewisses Problem. Ich habe etwas richtig gemacht, wenn meine eigene Meinung von den Musikern zurückkommt und sie denken, es sei ihre. Damit das Ergebnis lebendig ist, müssen sie überzeugt sein, nicht nur überredet.
Am schönsten wird die Musik hart an der Grenze, wie beim Rallyefahren.
Gerät man nicht ins Chaos, wenn 100 musikalische Musikermeinungen zusammentreffen?
Es gibt eine Struktur, aber wir machen keine Bildhauerei, ein solides Objekt. Eine lebendige Erzählung hat auch Improvisationselemente. Es gibt 1000 Möglichkeiten, eine Stelle zu spielen, aber wir beschränken uns auf acht, dadurch gibt es eine gegenseitige Inspiration. Man gibt eine Geste an und hat eine Idee, was zurückkommen soll. Manchmal kommt eine Überraschung und man denkt, na klar, das ist toll. Aber einer muss eine Richtung geben, sonst dauert das viel zu lang. Es gibt viele Bilder dafür, was ein Dirigent ist und was er tut. Zum Beispiel den Fallschirmlehrer. Die Musiker springen auch alleine, aber brauchen das Vertrauen, dass jemand das Schiff steuert. Am schönsten wird die Musik, wenn es gerade so funktioniert, hart an der Grenze, wie beim Rallyefahren. Die sind nicht total sicher, was läuft, aber trotzdem reiten alle die Welle.
Ist es für die Art der Interpretation und die Auftrittssituation von Belang, wer im Publikum sitzt? Schüler, Abonnenten oder ein Fachpublikum? Versucht man da Erwartungen gerecht zu werden?
Musik besteht aus zwei Halbkreisen: Dem derer, die sie machen und dem derer, die sie konsumieren. Man hört und spürt etwa Nervosität an häufigem Husten, wenn die musikalische Interpretation nicht stark, nicht fesselnd genug ist. Vielleicht verändern wir die Interpretation also in Wechselwirkung mit dem Publikum, ohne es zu merken. Aber wenn ich für Schulkinder oder für Besucher spiele, deren Eintritt frei ist, mache ich das Stück genauso wie für die Bamberger Abonnenten oder bei Kartenpreisen von über 200 Euro in den USA oder Japan.
Kann denn jeder verstehen, was Sie da tun?
Ich glaube, dass Musik für jeden ist. Sie grenzt niemanden aus. Die Musik kann durch ihre Sprache, die keine Wörter hat, die kompliziertesten philosophischen Gedanken ausdrücken. Das soll so gut gemacht sein, dass es eigentlich klar ist, was die Musik sagen soll. Beim Anfang der Pastorale sollte deshalb ein 6‑Jähriger dasselbe empfinden wie ein langjähriger Abonnent der Symphoniker. Das gilt auch für Zeitgenössisches. In der Tonalität gibt es unglaublich viel zu verstehen. Bei Atonalität gibt es diese Regeln nicht. Es gibt nichts in moderner Musik zu verstehen, weil sie neu ist. Der Ausspruch „Ich mag neue Musik nicht, weil ich sie nicht verstehe“ kann so nicht gelten.

Haben Sie schon Momente erlebt, in denen abstrakte Dinge durch die Musik greifbar wurden?
Ich glaube schon: Nehmen wir die 9. Symphonie Mahlers. Wenn man sie aktiv verfolgt, spürt man einen Kampf. Und es gibt ein Abschiedselement. Der Kampf mit dem Tod. Das „Ich will nicht sterben“. Eine Partiturseite vor dem Schluss kann man ein Bekenntnis hören: „Ok. Ich glaube nicht an Gott, aber ich sterbe jetzt.“ Ich glaube schon, dass alle die das miterlebt haben wissen, was es bedeutet zu sterben: „Habe ich Angst, selbst vernichtet zu werden oder kann Masse zu Energie werden?“ Ich glaube, dass solche Aussagen absolut substantiell sind und dass das Publikum weiß, worüber wir reden. Wenn man sagt, „Aber wie ist das, zu sterben?“, kann keiner von uns diese Frage beantworten, aber durch dieses Musikerlebnis kommt man nahe an eine Beschreibung heran. Daher glaube ich, dass Musik eine Kraft besitzt, das Unaussprechliche irgendwie wahrnehmbar zu machen. Man muss deshalb nicht der größte Intellektuelle sein oder ein riesiges Repertoire gehört haben, sondern man kann dies alles auch durch die physikalische Kraft, dies auszuhalten und mitzuerleben, erfahren. Durch Empfindungen, weniger durch den Kopf.
In der modernen Musik gibt es nichts zu verstehen.
Warum gibt es dann so wenig Menschen, die klassische Konzerte hören? Hat das klassische Genre ein falsches Image oder gibt es eine Scheu davor?
Wir haben vor 10 Jahren einen Werbespot für Erdinger Weißbier machen müssen. Die Verantwortlichen haben mir die Partitur und eine Hörprobe übergeben, die ich mir angehört und dann gesagt habe: „Wozu brauchen Sie ein Orchester?“ Die Antwort war: „Solange die Werbung klein gezeigt wird, ist das schon in Ordnung. Sobald die Werbung aber auf Leinwand projiziert wird, spüren die Adressaten schon die Kraftlosigkeit von am Computer produzierter Musik.“ Das heißt also, dass im Unterschied zu vier, sechs oder acht Boxen, im Orchester 100 oder mehr Schallquellen existieren und menschengemachten Klang erzeugen, der im Gegensatz zu metallischem, künstlichem eine größere Wirkung erzeugen kann. Wenn man das erlebt hat, ist der Effekt, dass man gierig oder ähnlich einer Droge abhängig von dieser Musik wird. Aber dazu muss man den ersten Schritt gemacht haben. Und das nicht nur einmal als Sechsjähriger in der Schulklasse. Auf einmal ist man vierzehn und es wird viel schwieriger, das alles anzusprechen. Und plötzlich ist man dreißig und kann wegen anderer Lebensperspektiven noch schwerer sensibilisiert werden. Als ich jung war, haben wir alle in der Schule gesungen, jeder. In der Generation nach uns wurde das vernachlässigt und ich glaube, jetzt kommt es wieder. Man muss früh genug erste Erfahrungen machen, so dass keine Scheu entstehen kann. Wie machen wir den ersten Schritt, das ist die große Frage. Gib mir jemanden, der still sitzen kann für zehn Minuten und man kann viel erreichen. Umgekehrt: Beim ersten Studentenkonzert kamen die Studenten aus dem Konzert und haben gesagt: „Was war denn das? Das war wie Crack.“
Wenn man Musikern zuhört, hat man nicht den Eindruck, dass sie jemals irgendetwas anderes gemacht haben in ihrem Leben. Waren Sie schon immer sicher, wo es hingeht?
Nein, aber ich hatte als Kind, als Sänger meine musikalischen Erlebnisse. Diese Erlebnisse waren besonders, weil man sehr jung in einem sehr professionellen Team gesungen hat. Es ist sehr viel Zeit, die man vor und nach der Schule investiert – öfter auch in den Ferien. Wegen dieses vehementen Cocktails wollte ich immer singen, hatte aber keine ausreichende Stimme. Als ich an der Universität Cambridge war, habe ich überlegt: „Was mache ich?“ Musikwissenschaft kann nicht das richtige sein. Ich bewarb mich als Programmierer bei British Railways. In einem dieser Bewerbungsgespräche sagte mein Gegenüber: „Schön, wir wollen Sie zum nächsten Gespräch einladen, aber es scheint mir, Sie sollten eigentlich Musiker sein.“ Wie macht man nun Musik, war dann die nächste Frage. Ich wollte Singen, habe Klavier gespielt, aber nur begleitet. Meine Aussicht war, ins Studio als Korrepetitor zu gehen, in Deutschland zu studieren und mir das Proben anzusehen. Man muss Glück haben, dass die Gelegenheit kommt. Und dann muss man genug Wagemut haben, um zu sagen: Ok, das mache ich.
Zum Glück gibt es ja genug Wagnisse, die man in der Musik eingehen kann, zumal sie selten ganz bei sich bleibt.
Das stimmt, klar, es gibt Musik in Poesie oder Musik in Literatur. Philosophie sowieso. Je mehr man entdeckt desto größer sind die fantastischen Dinge und desto kleiner ist man selbst und irgendwann ist es egal, wie klein ich bin. Ich bin einfach ein Teil des Ganzen. Auch Dirigieren ist so, weil wenn es gut läuft, macht das Orchester die Musik, das Publikum hört und ich bin der Magier, der erlaubt, dass das funktioniert. Wenn ich mein eigenes Ego hervorhole, stehe ich öfter im Weg dieser Vermittlung. Am besten ist es, wenn ich steuere, kontrolliere, helfe und schaue, dass alles funktioniert. So können alle feiern am Schluss und ich fühle, dass ich meinen Job gut gemacht habe. Und das ist eigentlich schön, oder?


Tim Förster, Unterfranke, Herkunft beim Sprechakt zum Glück unkenntlich. Seit Beginn des Studiums beim Ottfried, doch eigentlich Germanist, Philosoph und Musiker. Der Tubavirtuose und Radler hat ein Faible für Glossen und lässt Interviews gerne ausarten - zeitlich.