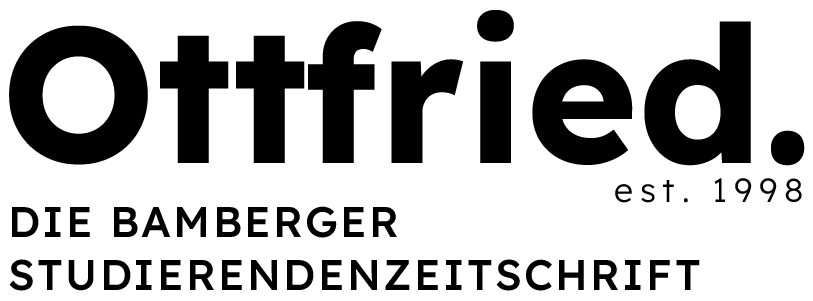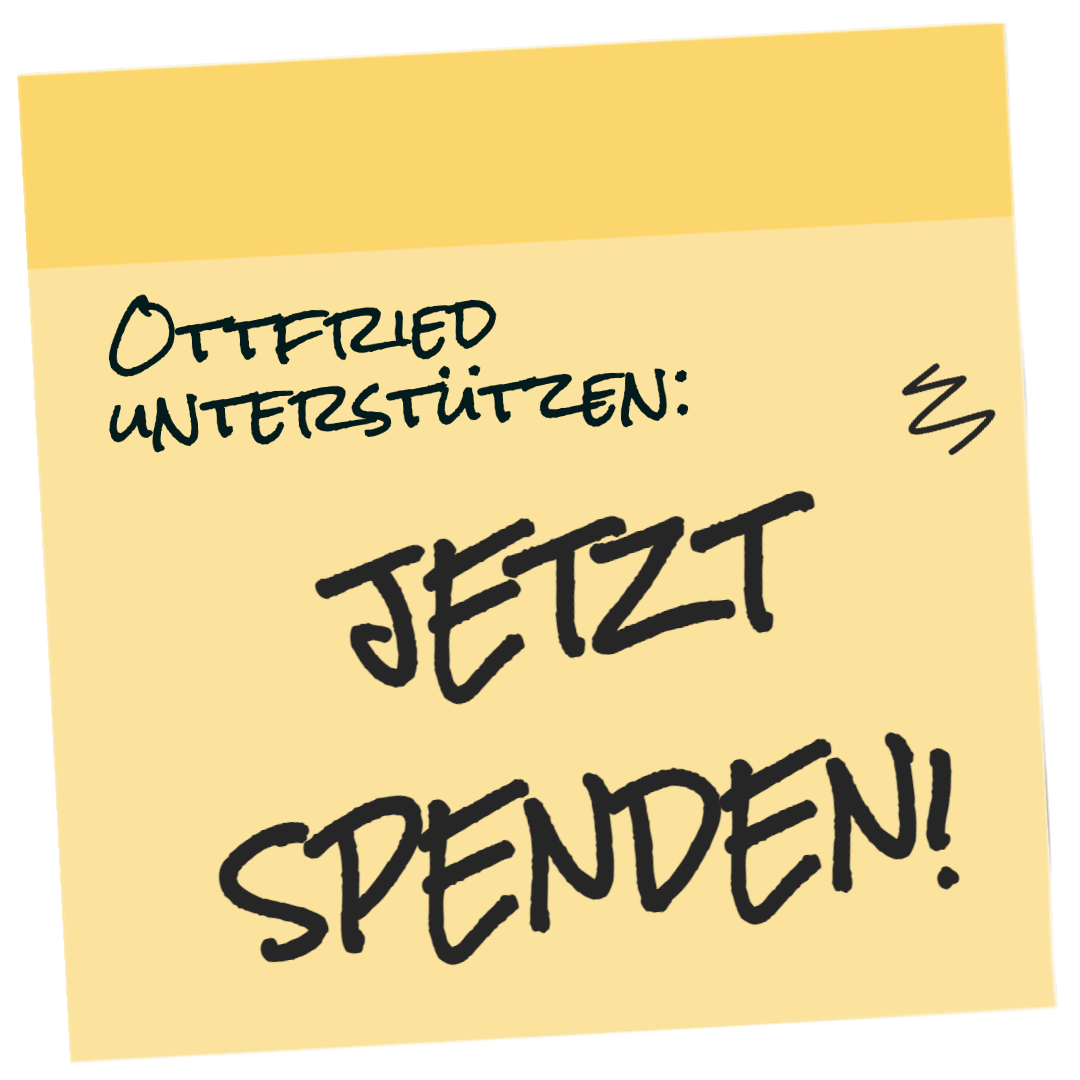Timotheus Riedel widmet sich primär der Germanistik, der Philosophie, der…
Eine der Hauptfiguren in deinem neuen Roman „36,9°“ ist der italienische Marxist Antonio Gramsci, der unter Mussolini elf Jahre bis zu seinem Tod im Gefängnis verbrachte. Wie bist du auf diesen Stoff gestoßen?
Als Kind, im Urlaub in Rom, habe ich schon mit meinem Vater an Gramscis Grab gestanden, ohne dass ich wirklich begriffen hätte, wer er war und für was er stand. Erst später, als ich mit Mitte 20 in Rom studiert habe, bin ich auf seine Bücher gestoßen. In Italien ist er ja noch viel präsenter als hierzulande. Da kaufte ich mir ein Buch und war gleich sehr eingenommen: Die Kombination aus seinem mutigen Denken, seiner ungewöhnlichen Biographie und den zärtlichen, lebendigen Briefen aus dem Gefängnis, die auch immer wieder tiefste Verzweiflung zeigen – das hat mir imponiert. Seine Lebensgeschichte erzählt auf ganz eigene Art sehr viel über das 20. Jahrhundert.
In deinen Romanen geht es oft darum, dass Menschen irgendwo zwischen Öffentlichkeit und Privatheit nach ihrem Leben suchen. Was fasziniert dich an dieser Thematik?
Mich interessiert der Mensch immer auch als politisches Wesen. Das Auseinanderdriften von Amt, Funktion, Rolle und Person: Jemandem wie Gramsci, der sich eigentlich der Politik verpflichtet fühlt, stößt plötzlich die große Liebe zu; während er in der KOMINTERN mit brennender Leidenschaft die Weltrevolution vorantreibt, begegnet ihm mit gleicher Heftigkeit ein ganz privates Gefühl. Diese beiden widersprüchlichen Momente zusammenzubringen, das fasziniert mich sehr.
Literatur soll den Leser in seinen Überzeugungen erschüttern und zum Nachdenken treiben.”
NORA BOSSONG, SCHRIFTSTELLERIN
Ist das dann politische Literatur?
Das Wort ist natürlich so ein Stempel, aber ich würde mich schon als gesellschaftlich kritischen Menschen einordnen. Ich kann mit Literatur mehr anfangen, die sich auch auf das große Ganze bezieht. Ich habe den Anspruch, mich nicht in einer privatistischen Schreiberei zu verlieren, das würde mich nicht interessieren und ich fände es auch ein wenig dekadent .
Darf Literatur moralisch sein?
Ja, aber in dem Sinne, dass sie verunsichert. Pädagogischer Literatur würde ich misstrauen. Literatur soll den Leser in seinen scheinbar festen Überzeugungen erschüttern und zum Nachdenken treiben.
Der Weltrevolutionär, der von einer banalen Verliebtheit erfasst wird – welche Rolle spielt das Absurde in deinem Schreiben?
Jede Figur hat ihre Absurditäten. Und man kann Figuren sehr gut zeichnen, indem man genau das zeigt. Wenn der Fokus vom großen Ganzen auf das ganz Kleine fährt, wenn der Weltrevolutionär zu einem schüchternen kleinen Menschen zusammenschrumpft – diese Absurdität prägt letztlich unser aller Leben. Daraus entwickelt sich eine Tragikomik. Das Tragische allein sagt eigentlich nicht viel – das Tragikomische zeigt die eigentlichen Konflikte und den Menschen in seiner Nicht-Erhabenheit.

Jonas Lüschers „Frühling der Barbaren“, Lukas Bärfuss‘ „Koala“, auch dein Roman „Webers Protokoll“: In einem ganzen Bündel junger Romane fallen Protagonisten in eine entscheidungs- und tatenlose Verweigerungshaltung. Woher kommt das?
Ich glaube, das ist eine Reaktion auf die omnipräsente Idee der Selbstoptimierung. Wir müssen ständig besser sein, wir müssen uns dauernd vermessen, unsere AppleWatch zeigt uns an, wie viele Liegestütze unseren Körper optimal auslasten, damit wir uns noch wohler fühlen. Heute muss alles sehr schnell sein und jeder muss eine Meinung zu allem haben. Da ist eine Verweigerungshaltung fast schon die denkbar politischste Haltung.
In „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ begegnet Luise Tietjen, die das Unternehmen ihres Vaters übernimmt, in der Männerdomäne der freien Wirtschaft große Herablassung. Ist das auch die Erfahrung einer jungen Frau, die in den Literaturbetrieb einsteigt?
Ich glaube, es ist eine häufige Erfahrung von jungen Frauen, die ganz gleich wo einsteigen. Es gibt immer noch Patriarchen, die Frauen als niedlich unterschätzen. Mit 17, 18 habe ich Schach gespielt, und wenn ich gegen Männer spielte, habe ich meistens gewonnen – weil sie dachten, sie müssten mir erstmal erklären, wie der Springer ziehen darf, anstatt mich als Gegnerin ernst zu nehmen. Im akademischen, im literarischen Betrieb werden junge Männer einfach schneller als gleichberechtigt ernstgenommen. Das wird sich sicher ändern, aber im Moment gibt es die Niedlichkeitsfalle noch.
Du hast am Literaturinstitut Leipzig studiert und dich darüber auch kritisch geäußert. Andererseits lehrst du inzwischen selbst dort und engagierst dich in der Bayerischen Akademie des Schreibens. Kann man Literatur lehren?
Man kann sie lehren, aber man kann sie nicht zu einhundert Prozent lehren. Jeder, der einen Roman schreibt, wird das zu einem großen Teil aus eigener Lektüre und eigenen Schreibversuchen hinbekommen müssen. Man kann Hilfestellungen geben, Lektorat, Tipps. Am Literaturinstitut stört mich, dass man dort drei Jahre das Gleiche macht: Textdiskussionen. Ein Jahr lang lernt man dabei etwas, danach ist es nur noch die traurige Wiederkehr des Gleichen. Irgendwann muss man sich auch mit Stoffen beschäftigen und alleine mit seinen Texten kämpfen.
Jüngst hast du in der Zeit kritisiert, dass die Lyrik es sich zu oft in einer Außenseiterrolle bequem mache. Woher kommt diese Haltung – und warum ist sie ganz falsch?
Zunächst kommt diese Haltung auch von außen – Lyrik wurde marginalisiert. Das ist auch ihr Vorteil: Für die Lyrik interessiert sich der Buchmarkt nicht. Das bedeutet sehr große Freiheiten. Was ich problematisch finde, ist, wenn man es sich in diesem Freiraum bequem macht und sich dabei heroisch und widerständisch findet, nur weil man unverständlich schreibt. Man muss sich entscheiden: Wenn man seine Arbeit als politisch begreift, aber dann dafür eine Ästhetik wählt, die ohnehin nur 54 Leute erreicht, dann sollte unter diesen 54 schon der Bundespräsident sein, damit das etwas bringt. Und Außenseitertum allein macht nicht zum Märtyrer. Heroisch ist man nicht, weil man von irgendwem irgendwohin gestellt wird, sondern weil man dort, wo man steht, irgendetwas macht.
Bitte mit kurzer Begründung – Goethe oder Schiller?
Goethe. Weil der „Faust“ einfach großartig ist.
Theater oder Kino?
Kino, weil ich den Filmschnitt und den Perspektivwechsel liebe.
Schwert oder Florett?
Florett, weil es viel eleganter ist.
Bamberg oder Bayreuth?
Bamberg, weil es da das Samshaus gibt.

Timotheus Riedel widmet sich primär der Germanistik, der Philosophie, der Geschichte – und dem Ottfried. Mag Reportagen, Feuilleton und Glossen. Der selbsternannte Literat spielt Gitarre seit Erfindung der Gitarre und hält sich für wesentlich lustiger, als er ist. Hat eine Schwäche für struppige Tierbabys und Philipp Lahm (was vielleicht in Zusammenhang steht).