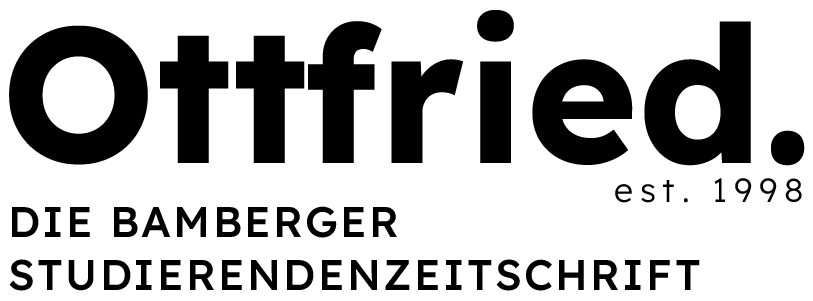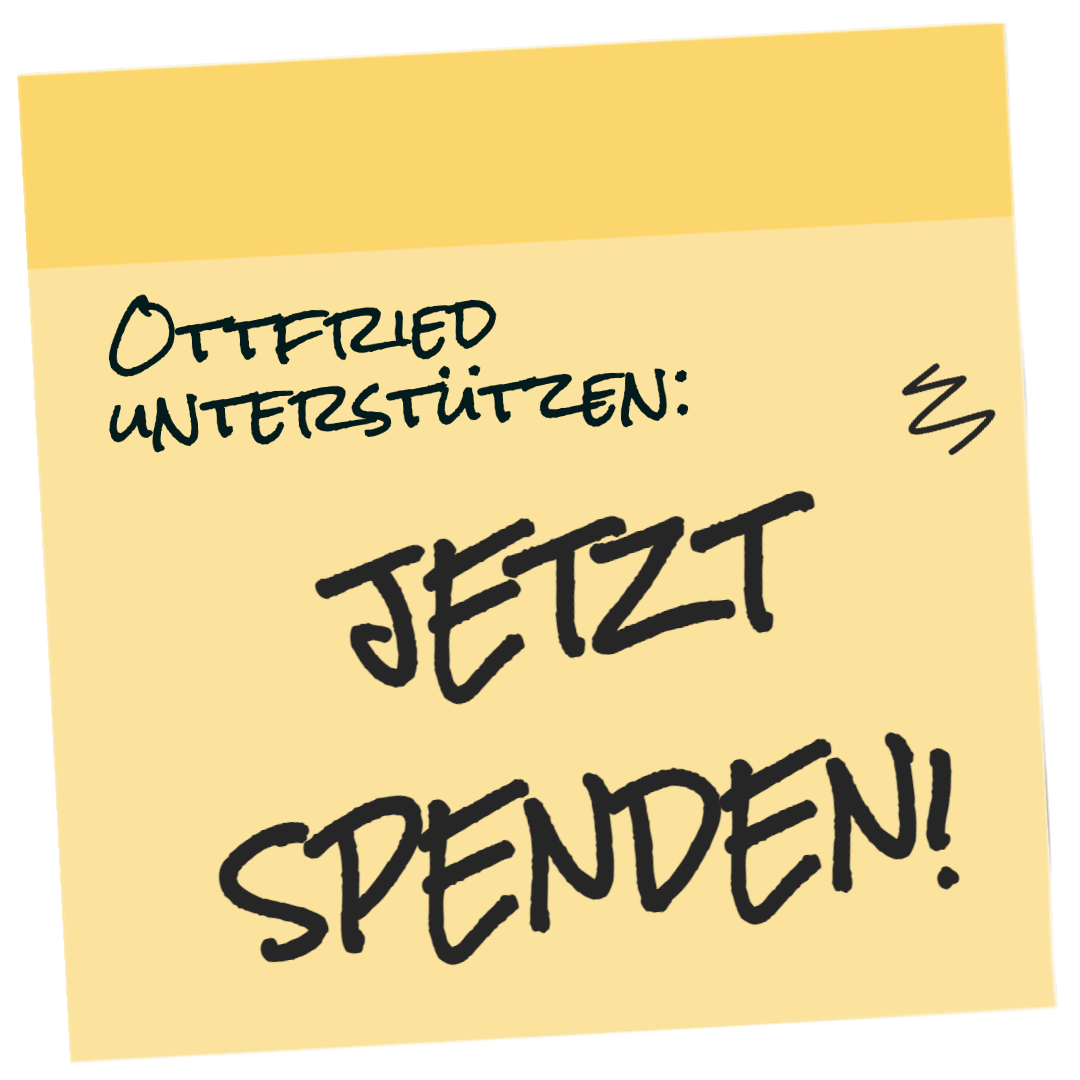Eine Frau in der fünften Reihe kreischt vor Lachen. Auf der Bühne hat Algernon, der Dandy, gerade begonnen, Queens Somebody to love zu singen – gekleidet in einen schwarzen Satinslip und einen offenen Morgenmantel. Im Hintergrund schieben Techniker einen künstlichen Kirschbaum mit japanischen Laternen auf die Bühne. Passend zum Titel: Ernst sein ist alles.
Das ist Bunbury, eine Adaption von Oscar Wildes Komödie „The importance of being Earnest“. Algernon und sein Freund Jack haben sich beide einen Bruder ausgedacht, um sozialen Zwängen zu entgehen: Bunbury und Ernst. Jack verliebt sich in die zickige Gwendolen, Algernon in Jacks Mündel Cecily. Die Männer geben sich beide als Jacks fiktiven Bruder „Ernst“ aus – denn die Frauen sind der Meinung: „Ich bemitleide jede Frau, deren Mann nicht Ernst heißt“. Doch die Frauen entdecken die Lüge. Das Wortspiel im Titel (Earnest/Ernest und auf Deutsch ernst/Ernst) weist auf die Hauptfrage hin: Sollte man ernst sein?
Muss man immer ernst sein?
Der Dandy Algernon zum Beispiel scheint nichts ernst zu nehmen: „Es ist so eine traurige Mode, dass Frauen mit ihren eigenen Ehemännern flirten. Es ist so, als würde man seine saubere Wäsche in der Öffentlichkeit waschen.“ Sein Motto und das seines Freundes Jack kehren die Aufforderung nach moralischem Handeln um: Tu das, worauf du Lust hast. Erfinde einen Bruder, wenn es dir hilft. Heirate, aber führe weiter eine Affäre mit einem Mann, wenn du Spaß dran hast.
Es ist eine schreckliche Sache für einen Mann, wenn er feststellen muss, dass er sein ganzes Leben die Wahrheit gesagt hat.
Cécile hingegen erträumt sich eine dreimonatige Beziehung mit Algernon, ohne ihn je getroffen zu haben. Diese Träumerei nimmt sie so ernst, dass sie sich nicht schämt, Algernon zu kritisieren, weil sie sich alle Liebesbriefe selbst schreiben musste.
Diese fiktive Beziehung nimmt auch Algernon ernst, sodass sie planen zu heiraten.
Durch die Absurdität und Verdrehung entstehen viele Witze. Aber es wird auch zum Nachdenken angeregt: Ginge es uns besser, wenn wir die scheinbar ernsten Dinge entspannter sehen würden und wenn wir die Träumereien nicht gleich als lächerlich abtäten?
Leicht zugänglich
Das Stück ist leicht zugänglich – zu leicht? Die Figuren sind Klischees, die man kennt: der Dandy, die Zicke, die strenge Tante. Natürlich hassen sich die beiden Frauen, als sie denken, sie lieben denselben Mann. Natürlich nennen sie sich „Schwester“, nachdem sie von der Lüge erfahren. Natürlich kommandiert die strenge Tante ihren Mann herum: „Gesundheit ist die oberste Pflicht im Leben. Ich sage das auch deinem Onkel immer wieder, aber es scheint ihn herzlich wenig zu interessieren.“ Doch das Stück traut sich, die Klischees nicht zu aufzubrechen, sondern sie ernst zu nehmen. Die Figuren sind nicht ein bisschen klischeehaft, sie nehmen die Rolle ganz an. Dadurch wird es erst lustig: „Warum sagen, wenn du es auch singen kannst.“
Dazu passen das Bühnenbild und die genialen Kostüme: Für das Schlussbild allein, das heißt weniger als eine Minute, wurde eine zwei Meter große Muschelschaukel aufgebaut, die mit weißem Plüschstoff und Glitzer ausgekleidet ist.
Leider war der zweite Teil weniger lustig als der erste: Der Versuch, es noch absurder zu machen, machte das Stück beliebig, zum Beispiel, als alle Figuren im Drogenrausch „freie Liebe“ skandierten. Auch der Bezug zum Leben Oscar Wildes; zum Beispiel in einer Szene, in der alle einen Wilde in Handschellen beleidigten, wirkte zufällig und fehl am Platz. Dabei meisterte das Stück die Balance zuvor gut: Es spielt zu Wildes Zeiten und spiegelt im Humor die Zwänge der Zeit, wirkte aber nicht veraltet.
Fazit
Insgesamt war es ein Event, ein Fest, ein Christopher Street Day als Theaterstück. Es war herrlich übertrieben und verdiente alle zehn Minuten Szenenapplaus. Das Stück ist ein Appell, nicht immer alle Dinge ernst zu nehmen. Andere aber unbedingt.